Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bedeutung der Begriffe und ihr Einfluss auf die Literatur
2.1 Subjekt
2.2 Masse
2.3 Kollektiv
3. Identitätskonstrukt einer Generation
3.1 Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W.
3.1.1 Inhaltswiedergabe und Erzählebene
3.1.2 Wirkungsgeschichte
3.1.3 Sprachliche Repräsentation: Jugendsprache und Generationenidentität
3.1.4 Gesellschaft und Jugend in der DDR
3.1.5 Edgar Wibeau als ein Teil des Kollektivs?
3.2 Florian Illies Generation Golf: Eine Inspektion
3.2.1 Inhaltsangabe
3.2.2 Wirkungsgeschichte
3.2.3 Sprachliche Repräsentation: Jugendsprache und Generationenidentität
3.2.5 Florian Illies: das Subjekt als Teil des Kollektivs?
4. Schlussbetrachtung
5. Literatur
1. Einleitung
Im Zuge der Konturierung von Subjektivität in der Moderne steht der Diskurs um das neuzeitliche Subjekt in Anbetracht seiner Existenz zwischen gesellschaftlicher Fortentwicklung und Krise.
Anhand der Texte von Ulrich Plenzdorf und Florian Illies soll aufgezeigt werden, dass durch subjektivistische Schreibweise das Konstrukt einer Identitätsbildung erzeugt werden kann.
Es stellt sich ferner die Frage, inwieweit sich das Subjekt innerhalb der Gesellschaft einem Kollektiv unterwirft und sich mittels Identifikation mit einem Kollektiv zur Generationsbildung beiträgt.
Die vorliegende Seminararbeit gliedert sich in drei Teilbereiche:
Zunächst werden die Begrifflichkeiten Subjekt, Masse und Kollektiv analysiert.
Die Vorgehensweise der Analyse gründet sich auf die Interaktion der drei Begrifflichkeiten, da das Subjekt immer auch im Zusammenhang mit Masse und Kollektiv zu betrachten ist.
Der komplexe Bereich des Subjektdiskurses soll an dieser Stelle nicht Gegenstand der Untersuchung sein, dennoch bedarf es der Definition eines literarischen Subjekts, um seine Rolle innerhalb des Kollektivverständnisses und der daraus resultierenden Generationsbildung durch Identität zu konsolidieren sowie innerhalb der literarischen und realen Umwelt zu beschreiben. Masse und Kollektiv können nur durch Mitglieder, durch Subjekte, dessen Denkstrukturen gemeinsame Kategorien aufweisen, existieren.
Auch wenn der Begriff der Masse innerhalb der Analyse nicht den Stellenwert eines Subjekts oder Kollektivs einnimmt, spielt er dennoch eine wichtige Rolle bei der Definition des Kollektivsbegriffs, da er sich aufgrund charakteristischer Attribute von diesem abgrenzt.
Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit konzentriert sich auf Identitätskonstrukte einer Generation, und zwar der Generation, die das Jugenddasein in der Spätmoderne zum Thema macht.
Im Mittelpunkt stehen Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W. und Florian Illies’ Generation Golf: Eine Inspektion, da sie jeweils ein Bild einer Generationenidentität entwerfen; Ulrich Plenzdorf in der Deutschen Demokratischen Republik und Florian Illies in der Bundesrepublik Deutschland.
Nach einem kurzen Abriss des Inhalts und einer detaillierten Beschreibung der Wirkungsgeschichte der vorliegenden Texte soll die sprachliche Repräsentation zur Bildung einer Generationenidentität hervorgehoben werden. Nicht nur der Inhalt der Werke sondern insbesondere die sprachliche Form bildet die Grundlage einer Identitätsbildung mit dem Kollektiv Jugend.
Die Analyse der von den Autoren verwendeten Sprachebenen dient der folgenden Einordnung des Subjekts in die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Merkmale der deutsch-deutschen Gesellschaften.
Auf Basis der vorgenannten Untersuchungen lässt sich dann die zentrale Frage nach dem Subjekt innerhalb des Kollektivs oder des kollektiven Subjekts beantworten.
In einer detaillierten Schlussbetrachtung soll ferner der Rückbezug zu den die Seminararbeit einleitenden Definitionsbegriffen herstellen, um die unterschiedlichen literarischen Formen von Generationssubjekten in DDR und BRD miteinander in Beziehung zu setzen und deren subjekttheoretische Ergebnisse im Kontext zur Generationenidentität zusammenzufassen.
2. Bedeutung der Begriffe und ihr Einfluss auf die Literatur
2.1 Subjekt
Das aus dem spätlateinischen subiectum (subicere = darunter werfen) entstandene Substantiv bedeutet dem Duden zufolge das „Zugrundeliegende“.[1] Auch im Brockhaus versteht man unter dem Begriff des Subjektes das „Seiende“ als das „Zugrundeliegende“ oder den Träger seiner Eigenschaften.[2]
In der Philosophie beschreibt das Subjekt ein mit Bewusstsein ausgestattetes, denkendes, erkennendes, handelndes Wesen, also das Ich als Denkendes, Erkennendes, Wollendes. Sozialisationsprozesse bilden Mitglieder des Systems zu sprach- und handlungsfähigen Subjekten heran.
Die Rückkehr zu sich selbst gibt dem Subjekt Selbstbewusstsein und freie Entfaltung. Das Ich als Subjekt setzt sich damit von allem anderen Seienden ab, indem es sich dem anderen Seienden gegenüberstellt (als Objekt oder ebenfalls als Subjekt). Die neue Erkenntnistheorie geht von einer solchen Subjekt-Objekt-Beziehung aus. Bei Heidegger und Kant findet man beispielsweise ein gegensätzliches Subjekt-Verständnis.
Seit dem 19. Jh. beschäftigt sich die Geisteswissenschaft mit dem Selbstverständnis einer modernen Subjekttheorie.
Paul Geyer schreibt in seinem Aufsatz Die Entdeckung des Modernen Subjekts: Anthropologie von Descartes bis Rousseau, dass
Descartes und Hobbes [...] mit ihren anthropologischen Entwürfen einen Klärungsprozess ein[leiten], der mit Jean-Jaques Rousseau zu einem vorläufigen Abschluss kommen wird. Festzuhalten ist dabei zunächst, dass die „Durchrationalisierung“ der Anthropologie keineswegs [...] als Irrweg oder gar Sündenfall der logozentrischen Selbstentfremdung des Menschen anzusehen ist. Sie ist vielmehr ein notwendiges Durchgangsstadium auf dem Weg zur modernen Subjektivität und ihrer Theorie.[3]
Weiterhin bezieht sich Paul Geyer auf die von Max Weber aufgezeigte Radikalisierung des exakten, technologischen Denkens, die Ausdifferenzierung einer dreipoligen Natur des Menschen, nämlich die kognitive, normative und private.[4] Durch diese Ausdifferenzierung, so Geyer, werde die wechselseitige Perspektivierung der drei Pole ermöglicht und aus diesem Prozess resultiere das moderne Subjekt.[5]
Nach einer genaueren Analyse dieses Subjektdiskurses kommt Paul Geyer zu dem Schluss, dass sich die drei genannten Prototypen sozialen Bewusstseins nicht länger unter einen Oberbegriff zusammenfassen lassen und behauptet weiter, dass damit eine Tradition endet, die unter dem Leitmotiv „Erkenne dich selbst“ steht. Diese Frage wird abgelöst durch die Frage „Was ist der (einzelne) Mensch?“[6]
Es besteht also weiterhin die Frage nach einer Modernen Anthropologie.
Auch Monika Schmitz-Emans eröffnet ihren Aufsatzes Das Subjekt als Literarisches Projekt oder: der Ich-Sager und Er-Sager mit der zentralen Frage „Wer sind wir eigentlich?“ oder drastischer „Sind wir wer?“[7] Sie beschreibt, was die Schwierigkeit einer Begriffsdefinition des Subjekts ausmacht, und zwar, dass weder [...] Konsens darüber [besteht], wie der Begriff des „Subjekts“ konkreter zu bestimmen sei, noch darüber, wie die gegenwärtige Situation (oder Nicht-Situation) dieser fraglichen Instanz beschrieben werden könnte.[8]
Auch sie verweist wie schon Paul Geyer auf Michel Foucault, der „das Ende jenes Diskurses diagnostiziert, der das Subjekt in den Mittelpunkt stellte.“[9] Bei Roland Barthes ist vom „Tod des Subjekts“ die Rede, auch wenn dieser Standpunkt noch immer diskutiert wird.
Was jedoch sowohl nach Geyer als auch nach Schmitz-Emans festgehalten werden kann, ist, dass sich das Subjekt derzeit in einer Krise befindet. Diese Krise des Subjekts ist auf die Stellung des Menschen in Raum, Zeit und Geschichte bezogen und beinhaltet Krisen der Artikulation, Krisen des Selbstbewusstseins, Kommunikationskrisen sowie Orientierungskrisen (somit auch Krisen des Sinns).[10]
Paul Geyer beschreibt weiterhin in seinem Aufsatz die enge Verknüpfung von Subjekt und Diskurs (Der Begriff des Diskurses soll an dieser Stelle jedoch nicht Gegenstand der Arbeit sein, da dies den Rahmen sprengen würde). In Bezug auf das Subjekt endet Paul Geyer seinen Aufsatz mit dem folgenden Satz, der genau wie Monika Schmitz-Ewans die Schwierigkeit der Definition unterstreicht: „In den Differenzen und Interferenzen der drei Diskurspole bekommt das moderne Subjekt seine Chance zur Authentizität.“[11]
Das Subjekt steht weiterhin in enger Verbindung mit dem Individuellen, auch wenn es nach Leopold von Wiese „keinen absoluten Individualismus“ gibt.[12]
2.2 Masse
Um dem Begriff der Masse näher zu kommen, empfiehlt sich eine genauere Analyse des für viele Zustände verwendeten Begriffs Masse. Der aus dem lateinischen massa abgeleitete Begriff bezeichnet im Allgemeinen eine große Anzahl oder Menge.
Im Gegensatz zum oben definierten Begriff des Subjekts beschreibt der Begriff der Masse einen großen Teil der Bevölkerung besonders im Hinblick auf das Fehlen individuellen, selbständigen Denkens und Handelns. In Bezug auf die Psychologie sowie die Soziologie versteht man unter Masse eine Vielzahl von Menschen, die im Unterschied zur Menge (welche eine zufällige zusammenhanglose Ansammlung von Individuen darstellt) überwiegend durch die gleiche Aufmerksamkeitsrichtung verbunden ist.
Im Gegensatz zu strukturierten Formen der Gesellschaft weist die Masse aber keine weitere wirksame innere Organisation auf. Es werden hauptsächlich zwei Formen der Masse unterschieden:
Mit der ersten ist die konkrete, aktuelle oder auch wirksame Masse gemeint, die als eine vorübergehende Ansammlung von Menschen, die durch gemeinsame Affekte verbunden sind, verstanden wird.
Die zweite Form ist die abstrakte oder latente Masse, welche die Gesamtheit von nicht unmittelbar verbundenen Menschen, die durch eine nationale oder soziale Struktur, durch gleiche Bedürfnisse oder Forderungen ein Potential bilden, das auf die politische und kulturelle Lage wirkt und als Gesamtheit in ihrer Einstellung und Entscheidung durch Außenlenkung beeinflussbar ist. Diese Art der Masse ist expansiv, dass heißt, dass jeder, der auf die affektiven Gehalte anspricht, „mitergriffen“ werden kann.
Auch Prof. Dr. Leopold von Wiese stellt in seiner Schrift Das Ich und das Kollektiv 1967 die Frage, wie die Soziologie den Begriff der Masse definieren soll.[13] Auch er greift auf die Unterscheidung von konkreter und latenter bzw. abstrakter Masse zurück, wobei die konkrete Masse durch Wahrnehmbarkeit gekennzeichnet sei und eine Vorstufe zu den Gruppen bilde. Die abstrakte Masse hingegen seien Gegenstände von Denk- und Gefühlsvorgängen, und bildeten daher die Grundlagen für die Entfaltung der Körperschaften.[14]
Dennoch verweist von Wiese auf den Zusammenhang und der Wechselwirkung von konkreter und abstrakter Masse, wenn er sagt: „Es gäbe keine konkrete Masse, wenn die abstrakte nicht vorhanden wäre, und die abstrakte Masse bildet sich immer wieder aus konkreten Massen.“[15]
Das Verhalten eines Individuums in der Masse ist bestimmt durch eine Veränderung seines psychischen Habitus (suggestibel).
Die von jeder Person in der Masse empfundene seelische Gleichrichtung der anderen führt zum Abbau der Hemmungen und zu emotionalen Handlungen. Das Handeln kann aber auch folgendes beinhalten: Entsagung, Ergebenheit, Uneigennützigkeit, Selbstaufopferung.
Die durch Teilhabe an einer Masse eintretende vorübergehende Entpersönlichung kann für den Einzelnen des damit verbundenen Gefühls der kollektiven Macht anziehend sein. Besondere Handlungsbereitschaft in der Masse zeigen besonders Menschen mit unsicherem sozialem Status. Durch emotionale Enthemmung kann auch ein Entlastungseffekt wirksam werden.
Die Massentheorie wird häufig auf gesellschaftliche Strukturen und besonders mit Blick auf den Nationalsozialismus analysiert, um der Frage nachzugehen, wie sich eine Person in einer Masse unter bestimmten Voraussetzungen verhält.
Begründer der Massensoziologie und Massenpsychologie war Le Bon (Die Totalität der Masse), dessen Theorien und Modelle später durch Sigmund Freud ergänzt wurden (Das Modell von ES, ICH und ÜBER-ICH).
Auch Theodor Geiger versucht, mit seiner Theorie 1927 die Massenpsychologie zu überwinden.
Fest steht, dass in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts die massenpsychologischen Begründungszusammenhänge den Fragen der Sozialwissenschaften kaum noch ausreichen. Markus Bernauer beschreibt in seinem Aufsatz Die Ästhetik der Masse nicht nur den Standpunkt Theodor Geigers (Die Masse und ihre Aktion, 1926), sondern auch die Positionen von Le Bon und Freud, die er wie folgt darstellt:
Le Bon: Masse und ihre Glieder befinden sich in ständiger Disposition zur Hypnose und machen sich steuerbar durch einen Hypnotiseur (Führer).[16]
Freud: Masse entsteht dadurch, dass die Einzelnen sich miteinander identifizieren weil sie ein identisches Ich-Ideal (Führer) internalisiert haben.[17]
Weiterhin schreibt Bernauer, dass alle Massen an das Subjekt gebunden und somit instabil seien. Somit wird der Masse eine gewisse Instabilität zugeschrieben. Dies unterstreicht den Hang der Sozialwissenschaften, die Masse häufig nur in Verbindung mit Revolten und Revolutionen zu beschreiben, auch wenn in den Zwanziger Jahren der Begriff der Masse kaum negativ belegt war, weil man damit das Ideal einer klassenlosen Gesellschaft mit einheitlichem Konsens und einheitlichem sozialen Willen verband.
David Riesmann spricht von Vergesellschaftung, in der vor 1900 die Traditionslenkung, während der Reformation die Innenlenkung und im 20. Jahrhundert die Außenlenkung vorherrsche. Bei Simmels Vorstellung von Masse und Individuum ist von der Formung einer Ich-Identität durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten und einzigen Wir-Identität die Rede.[18]
Auch wenn über den Begriff der Masse kaum ein einheitlicher Konsens besteht, sollten einige Aspekte zu diesem Begriff nicht außer Acht gelassen werden: Der Masse wird eine gewisse Dynamik zugeschrieben, d. h innerhalb der Masse können Emotionen auftreten oder Verhaltensweisen eines Gliedes der Masse ausgeschaltet werden.
Rationale Kräfte eines Einzelnen werden in der Masse ausgeschaltet, das Glied unterliegt einer Suggestion und überträgt eine (fremde) Meinung als seine eigene, somit kann Fremdes und Eigenes nur noch schwer unterschieden werden. Die hypnotische Ausschaltung der Rationalität kann die Kräfte des Unbewussten hervortreten lassen, es herrscht ein in der Masse atavistischer Zustand.
Ein weiterer Aspekt in der Beschreibung der Masse ist die Nachahmung, durch die eine neue Identität entsteht, d. h. die Masse selbst wird zur Sklavin des identischen Verhaltens.[19]
Gabriel Tarde beschreibt zwei Typen von Nachahmung: die spontane, unmittelbare , horizontale Nachahmung, bei der Einer vom Anderen dessen Verhalten als Mode nachahmt. Der zweite Typus der Nachahmung ist die vertikale, in der sich die Mitglieder einer Gruppe nicht gegenseitig nachahmen, da sie bereits ein älteres Gemeinsames haben, welches sie nachahmen (genuin). Das ältere Verhaltensvorbild wird durch eine unmittelbare soziale Umgebung ersetzt.[20]
In der Diskussion um den Begriff der Masse, die immer auch einen Diskurs um die Moderne Gesellschaft beinhaltet, wird deutlich, wie schwer sich die Soziologie im Allgemeinen und die Massenpsychologie im Speziellen tut, eine adäquate und ausdifferenzierte Definition des Massenbegriffs vorzulegen.
Der Begriff der Masse ist daher eng mit Begrifflichkeiten wie Individuum, Subjekt, Kollektiv, Nachahmung und Abgrenzung verknüpft, die man bei der Analyse der Masse nicht außer Betracht lassen sollte.
2.3 Kollektiv
Nach Duden ist das Kollektiv eine Gruppe, in der Menschen in einer Gemeinschaft zusammenleben. Gemeint ist auch eine in sozialistischen Staaten übliche, von gemeinsamen Zielvorstellungen und Überzeugungen getragene Arbeits- oder Produktionsgemeinschaft.[21]
Das aus dem Lateinischen (Gemeinschaft) entstandene Kollektiv ist eine auf Arbeits- oder Interessengemeinschaft beruhende Gruppenbildung im Sinn der marxistischen Menschenauffassung (Kollektivismus). Hiernach entwickelt sich der Mensch nur im Kollektiv zu seinen menschlichen Möglichkeiten. Daher spielen die Kollektive in den kommunistischen Staaten eine große Rolle und werden in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gebildet. Das Kollektivbewusstsein oder die Kollektivseele sind zentrale Begriffe in der Soziologie Durkheims; die allgemein umstrittene Annahme, dass die seelische Struktur des Einzelnen durch Denk- und Verhaltensmuster der Gruppe bestimmt wird, in der er lebt.
Um sich dem Begriff Kollektiv zu nähern, ist es sinnvoll, einen Schritt in der Geschichte zurückzugehen und einen Blick auf das Mittelalter zu werfen:
Seit der Renaissance wird das Ich als eine selbständige Größe betrachtet. Max Weber spricht an dieser Stelle von dem Hervortreten des „subjektiven Sinnes“.[22] Die Gegenüberstellung von Ich und Wir erscheint jedoch bereits in den Ideen und Vorstellungen der Antike.
Von Wiese nähert sich dem Begriff des Kollektivs mit der Betrachtung, dass Menschen seit jeher „in positiven und negativen (aufbauenden oder zerstörenden) Verbindungen mit anderen Menschen“[23] miteinander leben. Der Mensch ist also in wirtschaftliche, kulturelle und politische Gebilde verstrickt.
Aus den Beziehungen der Menschen untereinander entstehen organisierte soziale Gebilde. Diese wiederum sind so miteinander verbunden, dass man sie sich als Einheiten vorstellen kann. Unter Annäherung, Anpassung, Angleichung und Vereinigung können soziale Gebilde entstehen, die sich als Kollektiv beschreiben lassen. So analysiert von Wiese in seinem Aufsatz Das Ich und das Kollektiv weiter, dass sich in einer Gruppe oder einem Kollektiv Hauptmotive von Herrschen und Dienen herauskristallisieren, dessen Ausarbeitung hier aber nicht Gegenstand sein soll.
Die Entwicklung der Gesellschaft von der Antike bis in die Neuzeit weist das Prinzip des Dualismus (Beispiel: Staat / Kirche) auf, das „teils individualistische, teils kollektivistische Züge“[24] zeigt. Auch Wiese stellt in seinem Buch die Frage, die schon Monika Schmitz-Ewans in ihrem Aufsatz Das Subjekt als Literarisches Projekt oder: der Ich-Sager und Er-Sager stellte, nach dem, was wir eigentlich sind. Somit schließt sich der Kreis und man ist bei der Betrachtung zentraler Begrifflichkeiten wie Subjekt, Masse und Kollektiv wieder bei dem kleinsten Glied der Gesellschaft, dem Subjekt angelangt.
Fest steht, dass sich hinter dem Begriff Kollektiv eine Gemeinschaft, Gruppe oder Organisation verbirgt, die eine bewusste Zielausrichtung innehält.
Kritiker unterstellen der Bildung von Kollektiven hingegen, dass das Bewusstsein des Einzelnen innerhalb des Kollektivs durch das Bewusstsein der Gruppe als Gesamtheit verdrängt werde. Die persönliche Verantwortung werde durch die kollektive ersetzt, wie es auch Durkheim in seinen Theoriemodellen beschreibt.[25]
Das Kollektiv ist aber auch immer im Gegensatz zum Ich zu betrachten, wie von Wiese in folgenden Worten sehr treffend formuliert:
„ „Kollektiv“ möchte ich gerade wegen der Allgemeinheit des Begriffs und der Hervorhebung der Verbundenheit im Gegensatz zur Isoliertheit des Ichs wählen“.[26]
3. Identitätskonstrukt einer Generation
3.1 Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W.
3.1.1 Inhaltswiedergabe und Erzählebene
Plenzdorfs Text beginnt mit Todesanzeigen. Sie informieren den Leser über den plötzlichen Tod von Edgar Wibeau, den Protagonisten. Ab diesem Zeitpunkt wird der weitere Verlauf in der Retrospektive erzählt. Edgars Vater recherchiert nach den Ursachen des Unfalls. Er selber hat seinen Sohn seit 12 Jahren nicht mehr gesehen und auch keinen Kontakt zu Edgars Mutter, Else Wibeau, gehabt. Im Rahmen seiner Nachforschungen trifft er auf die Personen, die Edgar in seinem letzen Lebensabschnitt nahe standen. Hier verwendet Plenzdorf die einzelnen Dialoge als Erzählebene. Zuerst wendet sich Edgars Vater an seine Ex-Frau, später an Edgars besten Freund Willi, dann an Edgars große Liebe Charlie und ihren Ehemann sowie an Edgars Arbeitskollegen des VEB WIK Berlin. Jedes einzelne Gespräch wird von Edgar aus dem Jenseits kommentiert. Dabei verwendet er Zitate aus Goethes Werk „Die Leiden des jungen Werther“ und beginnt sich selber auf ironische Art zu analysieren.
Der siebzehnjährige Protagonist wächst in Mittenberg (DDR, heute: Brandenburg) allein bei seiner Mutter auf. Im ansässigen Hydraulikbetrieb hat seine Mutter die Leitung und dort macht Edgar auch seine Ausbildung zum Mechaniker. In seinem dritten Lehrjahr kommt es zu einer Auseinandersetzung mit seinem Ausbilder (Meister Flemming), dem Edgar daraufhin eine Metallplatte auf den Fuß fallen lässt. Bisher als Muster-Lehrling geltend stellt er sich nicht den Konsequenzen, sondern verlässt Mittenberg. Er reist mit seinem Freund Willi nach Ost-Berlin, um wie sein Vater dort Maler zu werden.
[...]
[1] Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden. 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Hrsg. und bearbeitet vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Duden-Redaktion unter der Leitung von Werner Scholz-Stubenrecht. Bd. 8. Mannheim u. a.: Dudenverlag 1999, S. 3806f.
[2] Brockhaus Enzyklopädie. 17., völlig neu bearb. Auflage des großen Brockhaus. Wiesbaden: F.A. Brockhaus 1969.
[3] Geyer, Paul: Die Entdeckung des modernen Subjekts: Anthropologie von Descartes bis Rousseau. Tübingen: Niemeyer, 1997, S. 259.
[4] Ebd.
[5] Ebd.
[6] Ebd., S. 263.
[7] Schmitz-Emans, Monika: Das Subjekt als literarisches Projekt oder: der Ich-Sager und Er-Sager. In: Komparatistik. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 1999 / 2000. Heidelberg: Synchron, 2000, S. 74.
[8] Ebd.
[9] Ebd., S. 75.
[10] Schmitz-Emans, Subjekt als literarisches Projekt, S. 77.
[11] Geyer, modernes Subjekt, S. 274.
[12] Wiese, Leopold von: Das Ich und das Kollektiv. Berlin: Duncker und Humboldt, 1967, S. 21.
[13] Ebd., S. 37.
[14] Ebd.
[15] Ebd.
[16] Bernauer, Markus: Die Ästhetik der Masse. Basel: Wiese, 1990, S. 61.
[17] Ebd.
[18] Ebd., S. 64.
[19] Ebd., S. 74.
[20] Ebd., S. 72.
[21] Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden. 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Hrsg. und bearbeitet vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Duden-Redaktion unter der Leitung von Werner Scholz-Stubenrecht. Bd. 5. Mannheim u. a.: Dudenverlag 1999, S. 2184.
[22] Wiese, Kollektiv, S. 63.
[23] Ebd., S. 21.
[24] Ebd., S. 65.
[25] Die Namen und deren Theoriemodelle in den Definitionstexten stammen, sofern sie keine eigene Fußnote tragen, aus: Geyer, Paul, Die Entdeckung des modernen Subjekts und Bernauer, Markus, Die Ästhetik der Masse.
[26] Wiese, Kollektiv, S. 9.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Udema (Autor:in)Sascha Engels (Autor:in), 2005, Die subjektivistische Schreibweise bei Ulrich Plenzdorf und Florian Illies im Kontext einer Generationenidentität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/79447
Kostenlos Autor werden
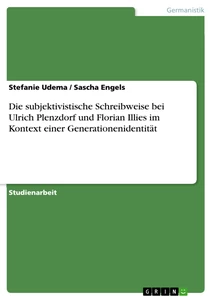
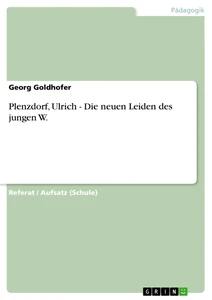
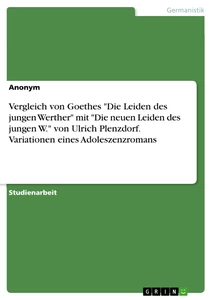
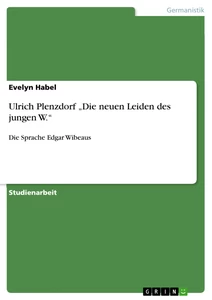
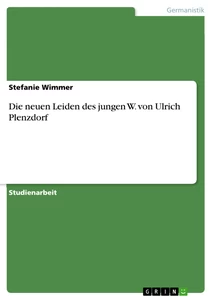

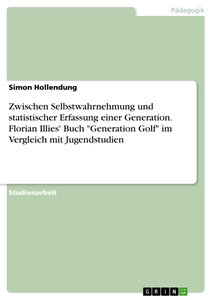
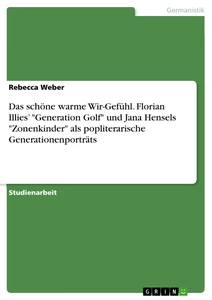
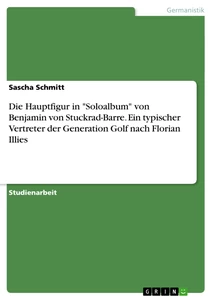
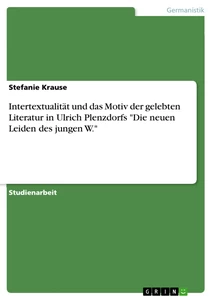

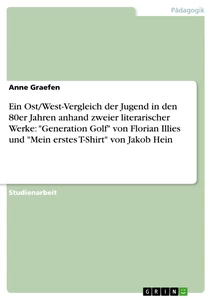



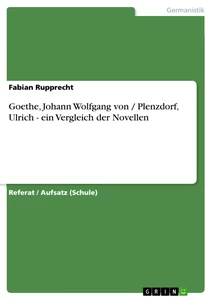


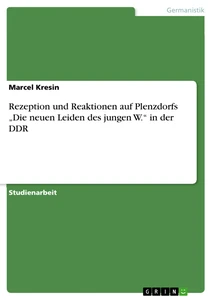
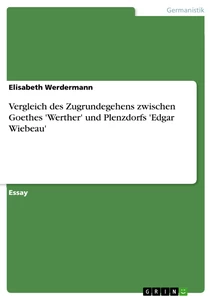
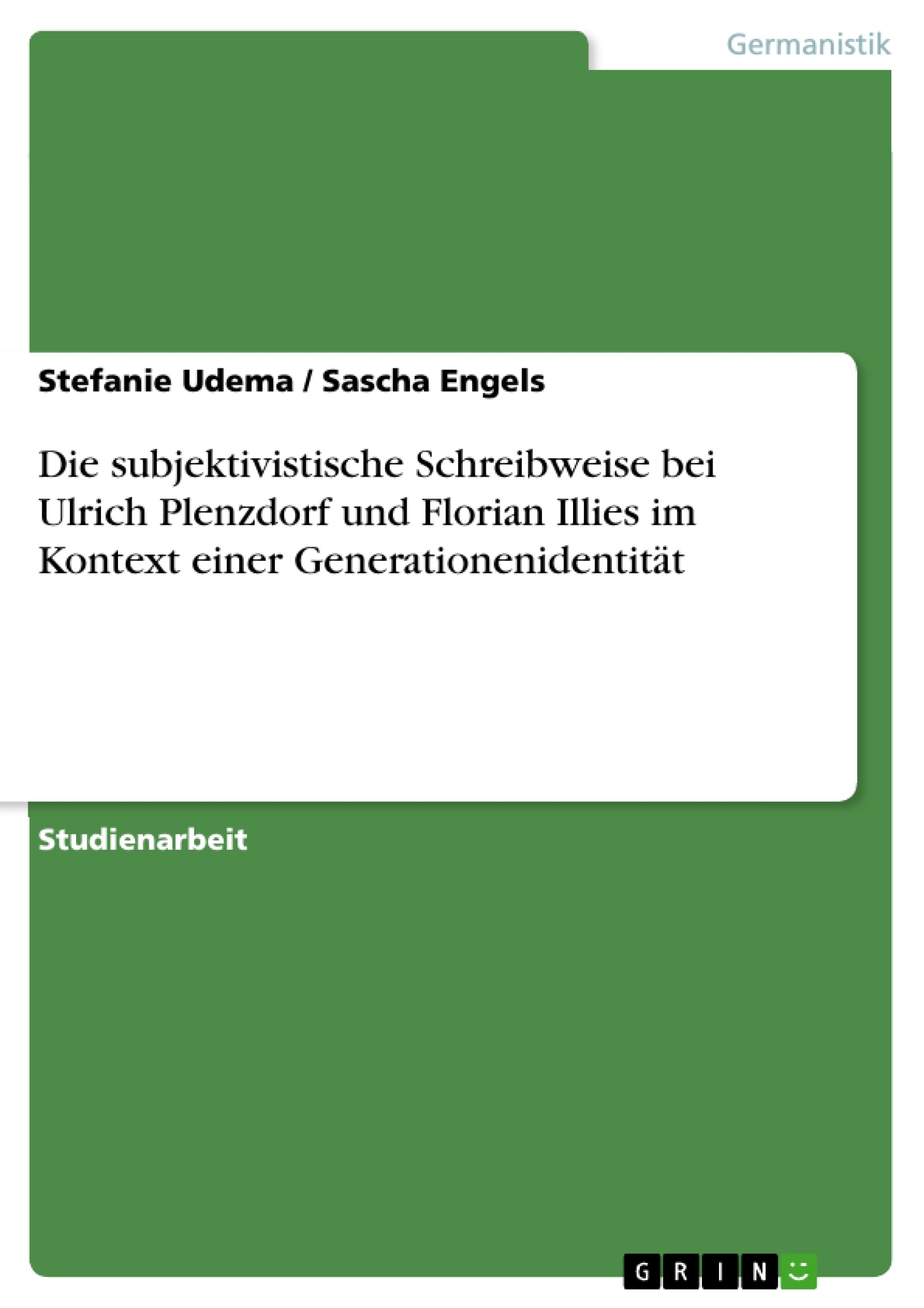

Kommentare