Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Entstehungsgeschichte
2.1 Textfassungen
2.2 Intertextuelle Bezüge
3 Lulu als Kaleidoskop unterschiedlicher Vorstellungen von Weiblichkeit
3.1 Lulu in der Rezeptionsgeschichte
3.2 Lulu: Femme fatale oder Femme enfant?
3.3 Lulu als Opfer
3.4 Lulu als Projektionsfläche
3.5 Lulu im Weiblichkeitsdiskurs ihrer Zeit
4 Fazit
5 Primärliteratur
6 Sekundärliteratur
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Hauptfigur aus Wedekinds ‚Lulu-Dramen‘, insbesondere soll der Frage nachgegangen werden, welches kritische Potential diese schillernde und schwer fassbare Figur aufweist. Das literarische Interesse konzentrierte sich von Beginn der Rezeptionsgeschichte an auf die Hauptfigur Lulu[1] und die Pluralität der Lulu Interpretationen im Laufe der Rezeptionsgeschichte ist auffallend groß. Lulu wurde von den Kritikern als das ewig Weibliche, als Femme fatale, als Femme enfant, als Naturprinzip, als Verkörperung einer ursprünglichen Sinnlichkeit, die von männlicher Rationalität unbelastet ist, als Verkörperung des reinen Triebes oder in krassem Gegensatz dazu, sogar der unbedingten Moral gesehen.[2] Die Uneinheitlichkeit der Darstellung der Hauptfigur, sowie der Interpretationen scheint dabei das einzig zentrale Merkmal des Lulu-Dramenkomplexes zu sein.
Dies geht soweit, dass es angesichts der gegensätzlichen Interpretationen angemessen erscheint, auch abgesehen von den verschiedenen Textfassungen von den verschiedenen ‚Lulus‘ der Interpreten zu sprechen. Gerade die Tatsache, dass Wedekinds ‚Lulu‘ bis in die jüngste Zeit auf das lebhafteste kritische Interesse gestoßen ist und auf sehr unterschiedliche Weise rezipiert wurde und wird, zeigt auf jeden Fall, dass die Diskussion noch lange nicht erschöpft ist und ‚Lulu‘ eine Schlüsselfigur zu sein scheint, an der sich unterschiedliche Vorstellungen von Weiblichkeit entzünden. Die vorliegende Arbeit versucht die Lulu-Gestalt – oder Lulu-Gestalten zu fassen, indem sie allgemein fragt, inwiefern die Lulu Figur als Teil des Weiblichkeitsdiskurses ihrer Zeit, also der Zeit um 1900 gesehen werden kann und inwiefern sie diesen Bezugsrahmen transzendiert und schon auf ein moderneres Frauenbild hinweist.[3] Wie sich zeigt, ist eine Beantwortung dieser Frage alles andere als einfach. Einerseits spielt der geschichtliche und kulturelle Kontext in der Positionsbestimmung der Lulu eine wichtige Rolle, andererseits kann dieser nicht vollständig rekonstruiert werden, da schon allein die Textgeschichte von Wedekinds ‚Lulu-Dramen‘ außergewöhnlich verwickelt und kompliziert ist und über die Entstehungsgeschichte der verschiedenen Fassungen und ihren künstlerischen Wert Uneinigkeit herrscht. In dem der vorliegenden Einleitung folgenden Abschnitt werde ich mich daher zunächst dieser Frage widmen und kurz auf die Diskussion über die verschiedenen intertextuellen Bezüge eingehen, da diese schon ein interessantes Licht auf die Hauptfigur werfen. Abschnitt 3 beginnt dann mit einem kurzen Blick auf wichtige Positionen der Rezeptionsgeschichte in Hinblick auf Lulu und untersucht die Hauptfigur dann unter verschiedenen Aspekten, und zwar Lulu als Femme fatale versus Femme enfant, Lulu als Opfer und Lulu als Projektionsfläche. Es geht dabei um Schlaglichter, die bestimmte Aspekte der Lulu in den Vordergrund rücken, wobei nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Widersprüche aufgelöst werden können, da diese, wie zu zeigen sein wird, in der Konzeption der Figur selbst begründet sind. In Abschnitt 4 erfolgt dann ein Versuch, die eingangs gestellte Frage nach dem kritischen Potential der Lulu zu beantworten und ihren Platz im Weiblichkeitsdiskurs ihrer Zeit zu bestimmen.
2 Entstehungsgeschichte
2.1 Textfassungen
Die Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte der Lulu-Tragödien, die nach Frühlings Erwachen zu den meistgespielten Stücken Wedekinds auf deutschen Bühnen gehören, ist verworren und zum Teil widersprüchlich. Wedekind, der von keinem anderen seiner Werke so lange in Anspruch genommen wurde[4], begann mit der Urfassung Die Büchse der Pandora[5]. Eine Monstretragödie im Jahr 1893.
Wedekind selbst begann noch im selben Jahr mit der Überarbeitung, teilte das Drama und veröffentlichte die überarbeiteten ersten drei Akte 1895 unter dem Namen Der Erdgeist, die für die zweite Auflage wieder ergänzt und überarbeitet wurden. Das zweite Drama, Die Büchse der Pandora wurde erst zwischen 1900 und 1901 bearbeitet. Auch in den späteren Ausgaben gab es immer wieder Änderungen, aber die größten Unterschiede bestehen zwischen der handschriftlichen Urfassung Die Büchse der Pandora. Eine Monstretragödie von 1894 und den überarbeiteten Erstdrucken der beiden nunmehr einzelnen Tragödien 1895 und 1902.[6]
Wedekinds Urfassung Die Büchse der Pandora. Eine Monstretragödie von 1894 liegt erst seit 1990 vor und zwar in der historisch-kritischen Ausgabe von Hartmut Vincon[7]. Der Text der Ausgabe letzter Hand (in den Gesammelten Werken von 1913) ist identisch mit der überarbeiteten Auflage des Erdgeists von 1910“.[8] Erhard Weidls 1990 herausgegebene Werksausgabe präsentiert den Text dieser Ausgabe letzter Hand.[9] Ruth Florack, die eine wichtige Rolle in der Rezeptionsgeschichte der ‚Lulu-Dramen‘ spielt, argumentiert, dass diese Ausgabe aufgrund des Anpassungsprozesses Wedekinds an die Zensur und durch seine Selbstzensur entstellt ist, die subversive Kraft und Vitalität der neugefundenen Urfassung verloren hat und aufgrund ihrer größeren Konventionalität von geringerem künstlerischem Wert ist.[10] Dem kann entgegen gehalten werden, dass dafür ästhetische Qualitäten in der Auseinandersetzung mit der konventionellen Kritik stärker herausgearbeitet wurden.[11] Eine ausführliche Diskussion der Positionen von Florack und Weidl würde über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen, ich schließe mich jedoch der Auffassung Liebrands an, die argumentiert, dass die Fassungen nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, da verschiedene Fassungen unterschiedliche Qualitäten aufweisen können - in diesem Fall radikale Modernität versus ästhetische Ökonomie - und dass die Textfassung der Weidl-Ausgabe für den Rezeptionsprozess von entscheidender Bedeutung war.[12] Aus diesem Grund wird diese Textfassung auch als Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit gewählt, wenn auch, wo es aufschlussreich erscheint, zum Vergleich auf andere Fassungen, insbesondere die Urfassung, eingegangen wird.
2.2 Intertextuelle Bezüge
Wedekind verarbeitete zahlreiche Anregungen in den ‚Lulu-Dramen‘, viele davon aus Paris, wo er seit 1891 von seinem Erbe lebte.[13] Dazu gehören Theater-, Varieté und Zirkusbesuche ebenso wie Erlebnisse mit Prostituierten und die literarische Lektüre. Da es keine Angaben Wedekinds selbst zu seinen literarischen Quellen gibt, ist die Forschung weitgehend auf Vermutungen angewiesen.[14] So galt lange Zeit Félicien Champsaurs 1888 uraufgeführte pantomime en un acte «Lulu, roman clownesque» als Hauptquelle. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Clownesse Lulu, die ihr Herz aus Stein verloren hat und es sucht. Während Schopenhauer, der das Herz findet, nichts damit anfangen kann, macht es Arlequin, dem sie es schließlich schenkt, nachdem sie es Schopenhauer abgelistet hat, glücklich.[15] Ruth Florack bezweifelte, dass es sich bei diesem Stück um die wichtigste Quelle handelt. Ihr zufolge ist nicht Champsaurs Lulu, die Clownesse danseuse, Vorbild für Wedekinds Figur sondern Lili, die Hauptfigur aus Catulle Mendès’ 1891 erschienenem Roman La femme enfant. Die unbewusst naiv-spielerische Art Lulus und ihre Kindlichkeit von Wedekinds Lulu erinnert demzufolge an die von Mendès entworfene Kindfrau. Dies wäre auch eine Erklärung für die widersprüchliche Gestaltung Lulus als Femme Fatale, die aber auch kindliche Züge aufweist, worauf in Abschnitt 3.2. noch genauer eingegangen wird.[16] Da es keinen Beweis dafür gibt, dass Wedekind die beiden Romane kannte, ist jedoch die Behauptung, dass eine der beiden Quellen die alleinige Hauptquelle ist, nicht haltbar. Ruth Florack zeigt viele interessante Parallelen zwischen der Monstretragödie und der französischen Unterhaltungsliteratur, zu der Vaudeville, Melodram und der Feuilletonroman gehören.[17] Weitere Beziehungen lassen sich zu anderen Werken von Mendès herstellen, wie die Monstres parisiens, Kurzgeschichten über erotische Frauen mit einem zerstörerischen Einfluss auf Männer. Auch die Sammlungen Mademoiselle Loulou und Petit Bob der Unterhaltungsautorin Gyp sind wichtig für ein Verständnis der Pariser Urfassung. Die dramaturgischen Verfahren aus der Traditon des Vaudeville und die heiteren Boulevardstücke von Henry Meilhac und Ludovic Halévy, sowie Alphonse Daudets Roman Sapho. Mœurs parisiennes (1884) und Emile Zolas Nana (1889/90), das Aufstieg und Fall einer Prostituierten schildert, stellen weitere wichtige Einflussquellen dar. Aber u.a. kommen auch deutsche Quellen wie das Drama Der Sumpf (1886) sowie Anregungen aus der deutschsprachigen Kolportageliteratur wie Yella, die Zirkuskönigin von Karl Hoffmann als Inspirationen für Wedekinds Lulu in Frage.[18]
3 Lulu als Kaleidoskop unterschiedlicher Vorstellungen von Weiblichkeit
3.1 Lulu in der Rezeptionsgeschichte
Wedekind wurde lange nur als Provokateur verstanden, der sich gegen bürgerliche Sexualtabus wandte, die Rezeption und auch Inszenierung seiner Stücke fokussierte auf Skandal und Erotik. Wissenschaftlichkeit und philologische Genauigkeit fehlten in der literaturwissenschaftlichen Rezeption über weite Strecken.[19] Im Folgenden wird kurz auf einige der wichtigsten Positionen der Rezeptionsgeschichte in Bezug auf diese schillernde Figur eingegangen.
Von Anfang an konzentrierte sich das Interesse auf die Hauptfigur, die, wie schon erwähnt, auffallend unterschiedlichen Interpretationen unterzogen wurde.
Von Artur Kutscher, der Weiblichkeit und Männlichkeit in der traditionellen Begriffsopposition von Natur – versus Kultur/Fleisch –versus Geist sah, wurde Lulu als Triebwesen und destruktive Kraft interpretiert. Laut Kutscher war Wedekind ein Gegner der im 19. Jahrhundert einsetzenden Emanzipationsbewegung, und wandte sich gegen eine Vermännlichung der Frau, die er wieder in den Urzustand der Natur zurückführen wollte.[20] In krassem Gegensatz dazu sah Wilhelm Emrich Lulu als Verkörperung der absoluten Moral.[21] Peter Michelsen widersprach dieser Auffassung vehement und betonte die komischen und grotesken Züge der Handlung und Lulus Existenz als rein fleischliches Wesen.[22] Für Wolfdietrich Rasch hingegen war Lulu nicht nur ein reines Triebwesen und er sah in dem Stück keine Glorifizierung der schrankenlosen sexuellen Freiheit, sondern meinte, dass Wedekind sich in den ‚Lulu-Dramen‘ gegen die verfehlte Art der Triebunterdrückung durch die bürgerliche Gesellschaft wendet.[23] Laut Rasch ist
Lulu […] gewiss eine Verkörperung weiblicher Sexualität, aber doch als Frau, als menschliches Wesen. Zudem ist sie auch Tänzerin, und so erotisch ihr Tanz akzentuiert ist, er ist doch eine Sublimierung ihrer Sexualität. Im Ganzen besteht Lulu keineswegs nur aus Triebhaftigkeit, sondern sie ist bestimmt durch eine innere Bindung an Dr. Schön, den sie liebt.[24]
Ende der 1970er-Jahre entdeckte die feministische Literaturwissenschaft Wedekinds ‚Lulu-Dramen‘, womit ein Paradigmenwechsel in der bis dahin männerdominierten Interpretationsgeschichte verbunden war. Diesbezüglich ist vor allem Silvia Bovenschens Interpretation hervorzuheben. Für sie ist Wedekinds Drama ein „Projektionsfeld für Weiblichkeitsmythen“, eine Sicht, auf die in Abschnitt 3.4. in Zusammenhang mit der Sicht auf Lulu als Projektionsfläche weiter Bezug genommen wird. Laut Bovenschen nehmen „die Männer […] in Lulu lediglich die Spiegelbilder ihrer Weiblichkeitsvorstellungen wahr. Die Katastrophen setzen ein, wenn sich das Bild, das sie sich jeweils von Lulu gemacht haben, mit dem Handeln und der Erscheinungsfigur dieser Figur nicht mehr deckt, weil sie in eine neue Rolle geschlüpft ist.“[25]
3.2 Lulu: Femme fatale oder Femme enfant?
Der vielleicht auffallendste Aspekt an Lulu als Figur ist der Kontrast zwischen Elementen der Kindlichkeit und Unbefangenheit und der Berechnung und Gefühlskälte. Eigenschaften der Femme fatale und Femme enfant kennzeichnen in unterschiedlichem Maß die Lulu der verschiedenen Dramenfassungen und wurde auch immer wieder von der Kritik hervorgehoben.[26] Wie schon in Abschnitt 2.2 ausgeführt, stellt Emile Zolas Drama Nana (1889/90), das Aufstieg und Fall einer Prostituierten schildert, eine der Einflussquellen für Wedekinds ‚Lulu-Dramen‘ dar. Nana wird darin als Femme fatale geschildert, die ihre Sinnlichkeit gezielt und mit Kalkül einsetzt um Macht über Männer zu erlangen. Während diese Züge in Wedekinds Monstretragödie fehlen, sind sie umso markanter im Erstdruck des Erdgeists ausgeführt. In den späteren Überarbeitungen des Erdgeist finden sich beide Züge, wie im Folgenden an einigen Beispielen gezeigt wird.
Zu den Zügen, die eine Femme fatale kennzeichnen, gehört die bewusste und absichtsvolle Verführung der Männer. In der Verführung von Schwarz wird Lulu zum Beispiel sehr aktiv und sich ihrer Wirkung durchaus bewusst gezeigt, wenn sie ihn als sein Modell ihn dazu auffordert ihre Lippen geöffnet zu malen und ihr „Beinkleid“, vor ihm stückweise hinaufzieht:
Lulu (das linke Beinkleid bis zum Knie hinaufraffend, zu Schwarz): So?
Schwarz: Ja…
Lulu (es um eine Idee höher raffend): So?
Schwarz: Ja, ja…“[27]
Aber gleichzeitig gibt es Elemente der kindlichen Unschuld, wenn sie zum Beispiel zu ihm sagt, „Ich wollte Ihnen nicht weh tun“[28]. Als sie nach dem Tod Golls zur Frau von Schwarz wird, scheinen ihre Kälte und Unzufriedenheit im Gegensatz zur Darstellung in der Monstretragödie weitgehend unbegründet zu sein.[29] Ohne unmittelbar ersichtlichen Grund ist sie schnippisch und kurz angebunden zu Schwarz:
Lulu: ([…] trennt sich vom Spiegel mit einem missmutigen zornigen Blick […]
Schwarz: Ich finde, du siehst heute außerordentlich reizend aus.
Lulu (mit einem Blick in den Spiegel): Es kommt auf die Ansprüche an.
Schwarz: Dein Haar atmet eine Morgenfrische…
Lulu: Ich komme aus dem Wasser.
Schwarz […]: Ich habe heute furchtbar zu tun.
Lulu: Das redest du dir ein.[30]
Nach dem blutigen Selbstmord ihres Mannes, der die Enthüllungen Schöns nicht ertragen konnte, durchsucht sie gefasst seinen Schreibtisch[31] und antwortet kaltblütig auf Schöns „Es ist deines Gatten Blut“ mit „Es lässt keine Flecken“, als sie ihm einen Blutflecken abwischt.[32] Die Reaktion des fremden Reporters, allerdings auf den Anblick des toten Schöns, ist dagegen von Schock und Entsetzen gekennzeichnet.[33] Im späteren Gespräch mit Schön, der die mittlerweile seinetwegen als Revuetänzerin arbeitende Lulu wegen ihrer Herkunft beleidigt und schroff auf ihren Platz als unanständige, schamlose Frau verweist, schwankt sie in wenigen Augenblicken zwischen trotziger Zustimmung („Und wie überglücklich ich dabei bin!“), Kindlichkeit, die in der Regieanweisung ausdrücklich erwähnt wird: „Lulu (kindlich bittend): Nur eine Minute noch. Ich bitte Sie. Ich kann mich noch nicht aufrecht halten.“, sowie treffsicherer Ironie, als sie zu Schön einen Moment später sagt „Sie hatten Ihren veredelnden Einfluss überschätzt?“[34] Diese Ambivalenz zieht sich durch das ganze Stück und macht es unmöglich, Lulu als eindeutig berechnend und kalt zu kategorisieren, auch wenn diese Elemente ihre Kindlichkeit und Spontanität zu überwiegen scheinen. Sie scheint zu Beginn durchaus echte Gefühle für Schön zu haben, im Endeffekt geht es jedoch nur darum, ihm ihre Macht zu beweisen[35], was sich auch daran zeigt, dass sie ihn nach der Heirat gleich mit mehreren Männern betrügt.
In der Büchse der Pandora sind die Merkmale der Femme fatale noch stärker ausgeprägt. Von Beginn an wird wiederholt auf Lulus Männerkonsum verwiesen[36] und sie schreckt nicht davor zurück, Schigolch kaltblütig zu einem, noch dazu vermeidbaren, Mord anzustiften. Gleichzeitig wird sie ihm gegenüber zum Kind, sie wird „von einem Weinkrampf überwältigt“ und „schluchzt krampfhaft“.[37] Als sie im dritten Akt zur Prostitution gezwungen ist, akzeptiert sie die Situation rasch und zeigt einen Eifer beim Kundensammeln, der nicht durch Einsamkeit oder Sehnsucht nach Nähe bedingt ist.[38] Dadurch erscheint sie einfach sexsüchtig, da es nicht einmal in erster Linie um das Geld zu gehen scheint:
Lulu (tonlos): Hat mich der Mensch erregt!
Alwa: Wieviel hat er dir gegeben?
Lulu (ebenso): Hier ist alles! Nimm! Ich gehe wieder hinunter.[39]
Insbesondere für eine Frau, - möge sie auch noch so ‚verworfen‘ sein nach den Moralvorstellungen ihrer Zeit-, die an ein völlig anderes Leben im Luxus gewöhnt ist, derart tief gefallen ist und sich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Freier von der Straße holen muss, ist diese Reaktion nicht sehr realistisch. Sie entspricht eher der Männerfantasie einer mannstollen Frau, die bezeichnend ist für die Lulu aus Die Büchse der Pandora.
Lulu mag zwar punktuell kalkulierend intrigant erscheinen, zum Beispiel wenn sie Schön in die Heirat manipuliert, insgesamt gesehen hat sie jedoch keine Kontrolle über ihr Leben, wie dies von einer Femme fatale, die zielsicher ihren eigenen Vorteil sichert, erwartet werden könnte. Lulu hingegen scheint eher von einer katastrophalen Situation in die andere zu stolpern. Sie hat die Zügel nicht in der Hand und reagiert nur auf das Chaos, das um sie herum ausbricht, bzw. das sie anrichtet, als ein Ehemann nach dem anderen das Zeitliche segnet. Auch in der Büchse der Pandora kann sie trotz aller Intrigen ihren Abstieg nicht aufhalten, Alwa weder vom Spiel noch vom Erwerb wertloser Aktien abbringen. Mehr noch, es gibt gar keine Bemühung von ihrer Seite Einfluss auszuüben um den Abstieg abzuwenden, abgesehen von ihren Versuchen, mit den Erpressern fertig zu werden.
[...]
[1] Vgl. Langemeyer, Peter: Frank Wedekind. Lulu. Erläuterungen und Dokumente, Philipp Reclam jun. GmbH&Co., Stuttgart, 2005, S. 174.
[2] Vgl. Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 174-189. (Vgl. Anm. 1)
[3] Besonders von einer modernen Warte aus gesehen ist diese Frage von Interesse, da aus einer Distanz von über einem Jahrhundert, eine Einordnung von Lulu in ihren gesellschaftlichen und historischen Kontext auch ein Licht auf die gesellschaftlichen Entwicklungen im letzten Jahrhundert wirft, insbesondere in Hinblick auf die verschiedenen, damals noch miteinander konkurrierenden Frauenbilder und die Entwicklung des modernen Frauenbildes. Dies ist ein Thema, das über die vorliegende Arbeit hinausweist.
[4] Wenn man berücksichtigt, dass Wedekind bis zur «Ausgabe letzter Hand» (1913) immer wieder Änderungen vornahm, dann arbeitete er mit Unterbrechungen etwa 20 Jahre lang an den Lulu Dramen. Vgl. Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 93. (Vgl. Anm. 1)
[5] Durch die Büchse der Pandora, die von Zeus an Pandora als Strafe für die Menschheit übergeben wurde, wurde nach der griechischen Mythologie das Schlechte in die Welt gebracht, die es davor nicht gekannt hatte. Gleichzeitig trägt „die Büchse“ in Wedekinds Drama sexuelle Konnotationen, was auf das Weibliche als Ursprung allen Übels hinweist.
[6] Vgl. Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 101 (Vgl. Anm. 1).
[7] Frank Wedekind: Die Büchse der Pandora. Eine Monstretragödie, historisch-kritische Ausgabe der Urfassung von 1894. Hrsg., kommentiert und mit einem Essay von Hartmut Vincon, Darmstadt 1990.
[8] Liebrand, Claudia: Noch einmal: Das wilde, schöne Tier Lulu. Rezeptionsgeschichte und Text. In Freiburger Literaturpsychologische Gespräche. Jahrbuch für Literatur und Psychoanalyse Band 20, S. 179.
[9] Frank Wedekind: Werke, Bd.1 und 2. Hrsg. mit Nachwort und Anmerkungen von Erhard Weidl. München 1990.
[10] Vgl. Florack, Ruth: Wedekinds “Lulu”. Zerrbild der Sinnlichkeit, Niemeyer, Tübingen, 1995. Auf Floracks Positionen wird im weiteren Laufe der Arbeit noch eingegangen.
[11] Vgl. z.B. Midgley, David: Wedekind, Erdgeist. In Landmarks in German Drama. Hrsg. von Peter Hutchinson. Oxford [u.a.]: Lang 2002, S. 158.
[12] Vgl. Liebrand: Noch einmal: Das wilde, schöne Tier Lulu, S.182. (Vgl. Anm. 8) Dazu kommt, dass es verschiedene Ursachen für die Textänderungen gegeben haben kann, die im Nachhinein nicht eindeutig rekonstruiert werden können. Neben der Rücksicht auf die Zensur, den Publikumsgeschmack und die Theaterkonventionen hat wahrscheinlich auch eine Selbstzensur aus künstlerischen Erwägungen eine Rolle gespielt. (Vgl. ebd.)
[13] Vgl. Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 93ff. (Vgl. Anm. 1) Im Sommer 1894 reichte er das Manuskript der «Monstretragödie» beim Buch- und Kunstverlag von Albert Langen, wurde jedoch abgewiesen, da der Verlag einen Konflikt mit den Zensurbehörden und einen öffentlichen Skandal fürchtete. Vgl. ebd.
[14] Vgl. Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 83. (Vgl. Anm. 1)
[15] Vgl. Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 83ff. (Vgl. Anm. 1)
[16] Vgl. Florack: Wedekinds „Lulu“, S. 19. (Vgl. Anm. 10); sowie Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 83ff. (Vgl. Anm. 1)
[17] Vgl. Florack: Wedekinds „Lulu“, S. 15ff. (Vgl. Anm. 10)
[18] Vgl. Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 83ff. (Vgl. Anm. 1)
[19] Vgl. Florack: Wedekinds „Lulu“, S. 1ff. (Vgl. Anm. 10)
[20] Vgl. Kutscher, Artur: Frank Wedekind. Sein Leben und seine Werke. Bd. 1. München, Georg Müller, 1922. Zit. nach Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 174ff. (Vgl. Anm. 1
[21] Emrich, Wilhelm: Wedekind: Die Lulu-Tragödie. In: Das deutsche Drama. Vom Barock bis zur Gegenwart. Interpretationen. Bd.2. Hrsg. von Benno von Wiese. Düsseldorf, August Bagel, 1980. Zit. nach Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 176ff. (Vgl. Anm. 1
[22] Michelsen, Peter: Frank Wedekind. In: Deutsche Dichter der Moderne. Ihr Leben und Werk. Hrsg. von Benno von Wiese. Berlin, Erich Schmidt, 1965. Zit. nach Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 178ff. (Vgl. Anm. 1)
[23] Rasch, Wolfdietrich: Sozialkritische Aspekte in Wedekinds dramatischer Dichtung. Sexualität, Kunst und Gesellschaft. In: Gestaltungsgeschichte und Gesellschaftsgeschichte. Literatur-, kunst- und musikwissenschaftliche Studien. In Zsarb. mit Käte Hamburger hrsg. von Helmut Kreuzer. Stuttgart, Metzler, 1969. Zit. nach Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 181ff. (Vgl. Anm. 1)
[24] Ebd., S. 182.
[25] Bovenschen, Sylvia: Inszenierung der inszenierten Weiblichkeit: Wedekinds „Lulu“ – paradigmatisch. In Bovenschen, Sylvia: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt, 1979, S. 47-52. Zit. nach Langemeyer: Frank Wedekind. Lulu, S. 185. (Vgl. Anm. 1)
[26] Vgl. u.a. Florack: Wedekinds „Lulu“. (Vgl. Anm. 10)
[27] Wedekind, Erdgeist I/2-3, S. 562. (Vgl. Anm. 9)
[28] Wedekind, Erdgeist I/4, S. 568. (Vgl. Anm. 9).
[29] Zum Vergleich zwischen den Fassungen vgl. Florack, Wedekinds „Lulu“, S. 188ff. (Vgl. Anm. 10)
[30] Wedekind, Erdgeist II/1, S. 576. (Vgl. Anm. 9).
[31] Vgl. Wedekind, Erdgeist II/6, S. 596. (Vgl. Anm. 9).
[32] Wedekind, Erdgeist II/7, S. 598. (Vgl. Anm. 9).
[33] Vgl. Wedekind, Erdgeist II/7, S. 599. (Vgl. Anm. 9).
[34] Wedekind, Erdgeist III/10, S. 613. (Vgl. Anm. 9).
[35] Das Gespräch hinter der Bühne, das mit Schöns Beleidigungen und seiner Aufforderung, ihn und seine Braut in Ruhe zu lassen, beginnt, artet in einen Machtkampf. Als Lulu im Begriff ist, diesen zu gewinnen, reagiert sie auf sein „Oh! Oh! du tust mir weh!“ mit „Mir tut dieser Augenblick wohl – ich kann nicht sagen wie!“ Wedekind, Erdgeist III/10, S. 616. (Vgl. Anm. 9)
[36] So zum Beispiel Casti-Piani zu Lulu: „Du liebst schon zu lang.“ Wedekind, Die Büchse der Pandora II, S. 676. (Vgl. Anm. 9)
[37] Wedekind, Die Büchse der Pandora II, S. 689. (Vgl. Anm. 9)
[38] Zum Vergleich mit der Monstretragödie, in der Lulu auf die Aussicht sich prostitiuieren zu müssen, viel negativer reagiert vgl. Florack, Wedekinds „Lulu“, S. 229. (Vgl. Anm. 10)
[39] Wedekind, Die Büchse der Pandora III, S. 707. (Vgl. Anm. 9)
- Arbeit zitieren
- Sabine Nittnaus (Autor:in), 2014, Frank Wedekinds 'Lulu' und ihr zeit- und kulturkritisches Potential, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320522
Kostenlos Autor werden
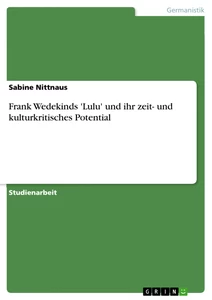
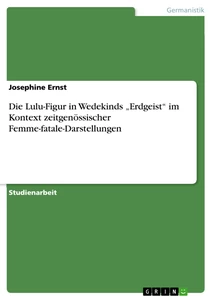
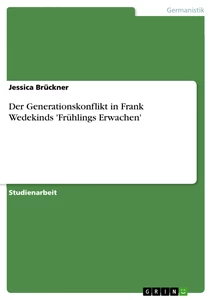



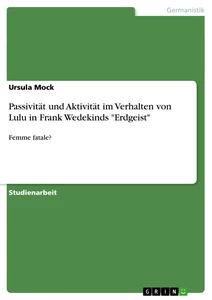


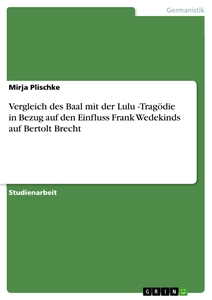
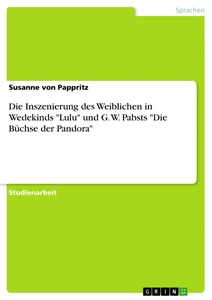

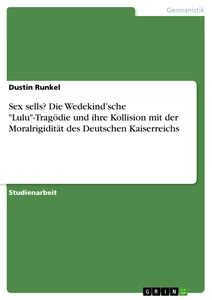

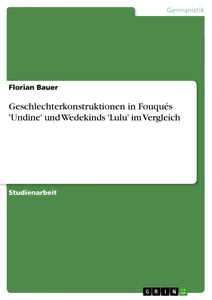



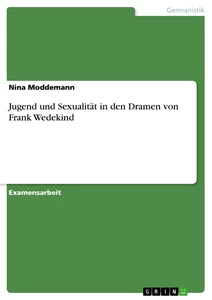
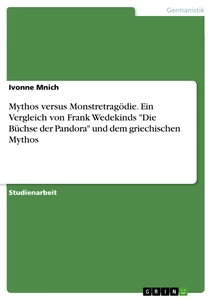
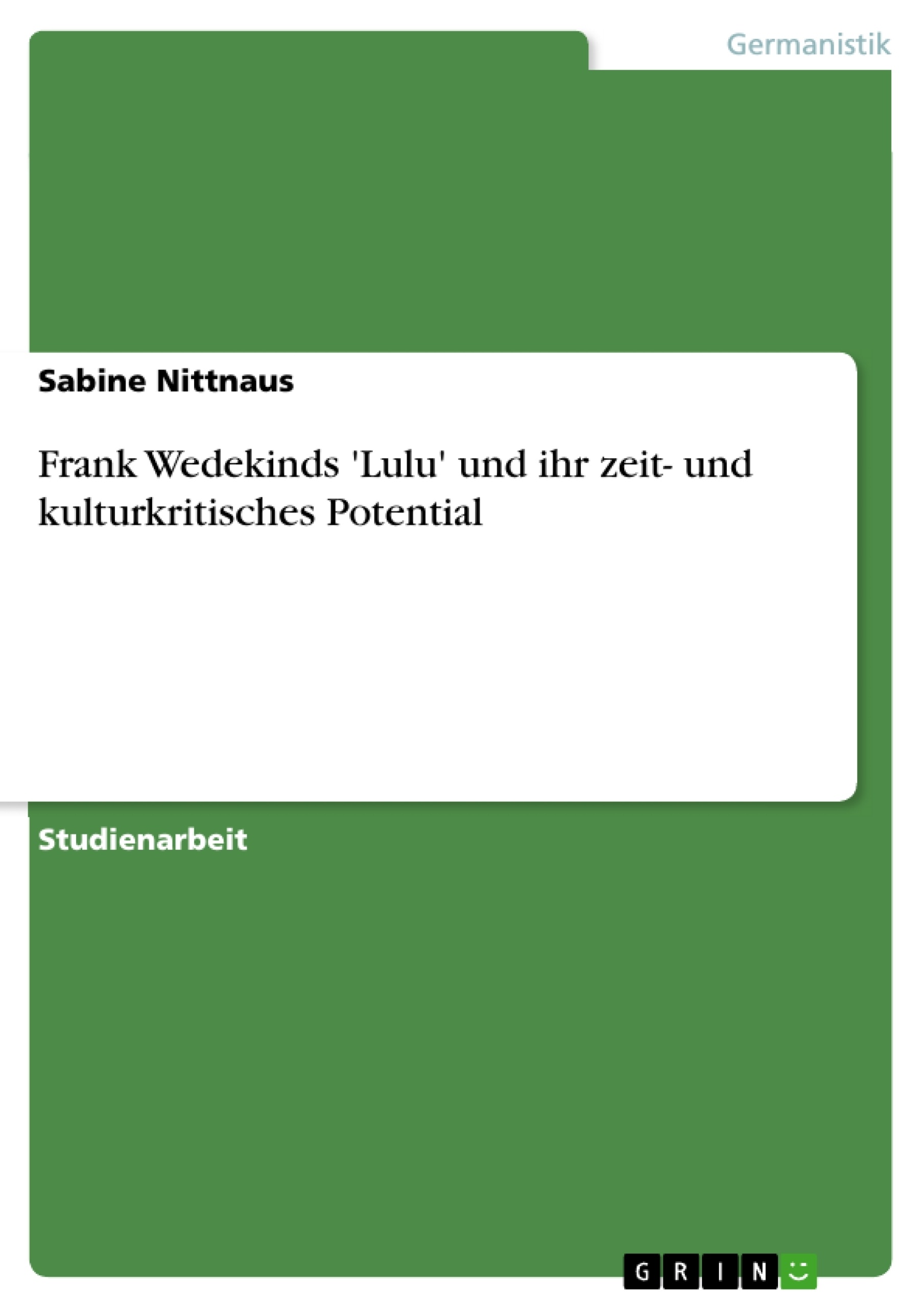

Kommentare