Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Existenzphilosophie Søren Kierkegaards
3. Kierkegaard-Rezeption im Stiller
3.1. Resignation und Verzweiflung
3.2. Wiederholung
3.3. Wahl
3.4. Sprung
4. Resümee
5. Bibliographie
1. Einleitung
Wer oder was sind wir? Diese Frage könnte als Leitsatz für Max Frischs Roman Stiller gelten, wie im übrigen für viele seiner Werke. Man bezeichnet diesen Roman auch als »Identitätsroman des Zwanzigsten Jahrhunderts«. Doch was genau bedeutet das? Seit seinem Erscheinen im Jahre 1954 hat man den Stiller unter zahlreichen Aspekten interpretiert, dabei ist die Forschung zu recht unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Der Grund hierfür liegt wohl in der Komplexität des Romans, er lässt sich kaum mit einer Gesamtinterpretation erfassen. Verständlich also, dass es zum Stiller ausschließlich Schwerpunktinterpretationen gibt; auf die wichtigsten sei hier kurz verwiesen.
Soziologisch betrachtet handelt dieser Roman von der Problematik des in der Gesellschaft durch Rollenmuster determinierten Individuums und dessen vergeblicher Versuche, diesen Klischees zu entfliehen – verstanden als Revolte gegen die Umwelt samt ihrer vorgefertigten Denkmuster.
Des Weiteren ließe eine Interpretation unter psychologischen, genauer: psychoanalytischen, Gesichtspunkten den Schluss zu, es handele sich bei Frischs Roman um eine Art Studie über eine geradezu neurotisch veranlagte Persönlichkeit, den Protagonisten Ludwig Anatol Stiller, welcher stets bemüht ist, seinen Minderwertigkeitskomplexen und der damit verbundenen Angst vor dem Versagen als Mann, Künstler und schließlich als Mensch zu entfliehen.
Eine dritte Methode wäre die Interpretation aus dem philosophisch-theologischen Blickwinkel. Zwar ist auch dies nur ein Teilaspekt einer Interpretation, doch erst mit diesem Ansatz erhalten wir eine umfassendere Möglichkeit der Erklärung des Stiller. Viele seiner Werke zeugen von einer intensiven Auseinandersetzung Max Frischs mit den philosophischen Schriften Søren Kierkegaards. So beispielsweise das 1964 erschienene Prosastück Mein Name sei Gantenbein oder die Komödie Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie. Trotz der besonderen Bedeutung kierkegaardschen Denkens vor allem für die Entstehung des Stiller haben sich nur wenige Literaturwissenschaftler mit dieser Thematik beschäftigt – und dies zumeist nur in kurzen Abhandlungen. Sehr lange beschränkte sich die Forschung auf eine soziologische oder psychologische Deutung.[1] Daher erschien es mir sinnvoll, die folgenden Untersuchungen, im Anschluss an einen kurzen Überblick zur Philosophie Søren Kierkegaards, ausschließlich auf die Kierkegaard-Rezeption im Stiller zu konzentrieren. Ziel dieser Arbeit ist es also aufzuzeigen, inwieweit die Hauptfigur des Romans eine Entwicklung im kierkegaardschen Sinne durchläuft.
2. Die Existenzphilosophie Søren Kierkegaards
Um die Werke Max Frischs mit Kierkegaard in Verbindung zu setzen, sollte man die Philosophie des Dänen zumindest in ihren Grundzügen kennen. In diesem Kapitel wird kurz auf seine zentralen Überlegungen, die sich an vielen Stellen auch im Gantenbein wiederfinden, eingegangen werden.[2]
Kierkegaards Philosophie war gegen die systematische Philosophie Hegels gerichtet, welche die Widersprüche des Lebens, Thesen und Antithesen, aufhebt und auf eine höhere Einheit, die der Synthese, zurückführt. Kierkegaard ging es um die Einbeziehung und vor allem um die Bindung des Individuums in seiner Philosophie. Ein vom Menschen selbst geschaffenes Gesetz ist nicht bindend, seine Wahrheit kann immer angezweifelt und angefochten werden. Folglich hilft es dem Individuum nicht bei existentiellen Entscheidungen, so dass wir ein äußeres Gesetz, nämlich den Glauben, als Verbindlichkeit anerkennen müssen. Doch genau hier liegt die Schwierigkeit, denn der (religiöse) Glaube ist rational nicht fassbar und fordert vom Individuum somit den Sprung vom Bekannten ins Unbekannte. Bevor ein Mensch jedoch diesen Schritt hin zum Glauben vollziehen kann, muss er zunächst sich Selbst annehmen. Diese Selbstwahl bedeutet nichts anderes, als dass der Mensch danach strebt, er selbst zu werden.
Kierkegaard nennt uns drei Stadien der menschlichen Existenz, nämlich das ästhetische, das ethische und zuletzt das religiöse Stadium. Der ästhetische Mensch bindet sich niemals an zurückliegende Entscheidungen, er lebt sozusagen ohne selbstgesteuerte Entwicklung auf ein bestimmtes Ziel. Er ist nicht frei, da er von äußeren Umständen bestimmt wird. Im Gegensatz dazu verpflichtet sich der ethische Mensch durch die verbindliche Annahme seiner früheren Entscheidungen und will somit seine eigene Entwicklung.
Zum religiösen Stadium gelangt das Individuum, wenn es bei sich selbst angekommen ist, also absolute Innerlichkeit erreicht hat. Dazu muss es resignieren, gewollt der äußeren Wirklichkeit entsagen und sein Denken und Handeln auf ein höheres Ziel ausrichten. Von dort gelangt der Mensch zur wahren Wiederholung. Indem er die Vergangenheit als seine erkennt und bewusst zu einem Teil seines Selbst macht, kann er diese Geschichte zu seiner Gegenwart und Zukunft machen. Er ist also im Begriff, sich selbst zu wählen, um danach den Sprung in den Glauben zu wagen.
3. Kierkegaard-Rezeption im Stiller
Im Folgenden soll der Stiller, wie eingangs bereits erwähnt worden ist, mit Hilfe der kierkegaardschen Philosophie eingehender betrachtet werden. Ganz bewusst werden hier die kierkegaardschen Kategorien verwendet, was bei dem Versuch hilfreich sein soll, einen direkten Vergleich zwischen Max Frischs Stiller und den Schriften Søren Kierkegaards anzustrengen. Aufgrund der Kürze dieser Arbeit kann dies allerdings nur in einem eingeschränkten Umfang geschehen. Zudem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Kierkegaard nicht gerade leicht zu verstehen ist. Es muss demnach auch die Frage gestellt werden, wie Frisch selbst Kierkegaard verstanden und literarisch verarbeitet hat.
Dem Roman vorangestellt sind zwei Zitate aus Kierkegaards Werk Entweder - Oder, sie dienen dem Leser als Motti für den weiteren Handlungsverlauf. Wiedergegeben sind hier die Originalzitate aus der Übersetzung von Emanuel Hirsch:
»Siehe, daher kommt es, daß es den Menschen so schwer fällt, sich selbst zu wählen, weil hier die schlechthinnige Vereinzelung (Isolierung) mit der tiefsten Gemeinschaft (Continuität) in eins fällt, weil da, solange man nicht sich selbst gewählt hat, gleichsam eine Möglichkeit besteht, etwas andres zu werden, entweder auf die eine oder auf die andre Weise.«[3]
»[…]; denn wenn der Freiheit Leidenschaft in ihm erwacht ist – und sie ist erwacht in der Wahl, ebenso wie sie sich selbst voraussetzt in der Wahl –, wählt er sich selbst und kämpft für jenen Besitz als für seine Seligkeit, und es ist seine Seligkeit.«[4]
Frisch kehrt allerdings die Reihenfolge der Zitate um, im Originaltext folgt das erste Motto dem zweiten. Es wird noch zu klären sein, welche Bedeutung beide Motti für das Romangeschehen im Stiller haben und was Frisch mit der erwähnten Umkehrung bezweckt. Vorwegnehmend kann hier schon gesagt werden, dass nicht eindeutig ist, ob Frisch selbst als Autor die Zitate verwendet oder er den Staatsanwalt diese dem ersten Teil, Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis, sozusagen als persönlichen Kommentar hinzufügen lässt.[5]
[...]
[1] Vgl. u.a. Gunda Lusser-Mertelsmann: Max Frisch. Die Identitätsproblematik in seinem Werk aus psychoanalytischer Sicht, Stuttgart 1976 (= Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik, Nr. 15), Manfred E. Schuchmann: Der Autor als Zeitgenosse. Gesellschaftliche Aspekte in Max Frischs Werk, Frankfurt a. Main 1979 (= Europäische Hochschulschriften, Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur, Bd. 296) u. Monika Wintsch-Spiess: Zum Problem der Identität im Werk Max Frischs, Diss. Zürich 1965.
[2] Eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Punkte kierkegaardschen Denkens findet sich bei Philip Manger: Kierkegaard in Max Frischs »Stiller«, in: Walter Schmitz (Hrsg.): Materialien zu Max Frischs »Stiller«, Bd. 1, Frankfurt a. Main 1978, S. 221-224.
[3] Søren Kierkegaard: Entweder - Oder, Bd. 2, übers. v. Emanuel Hirsch, Düsseldorf 1957, S. 231.
[4] Ebd., S. 230.
[5] Vgl. Wolfgang Stemmler: Max Frisch, Heinrich Böll und Sören Kierkegaard, Diss. München 1972, S. 49 f.
- Arbeit zitieren
- Dirk Bessell (Autor:in), 1998, Von der Schwierigkeit der Selbstwahl - Kierkegaard in Max Frischs "Stiller", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69747
Kostenlos Autor werden

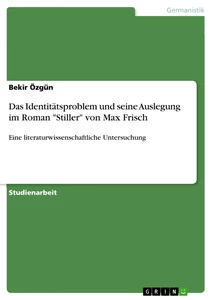



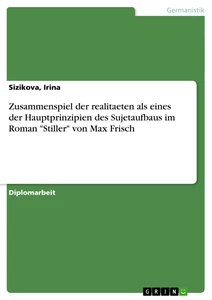
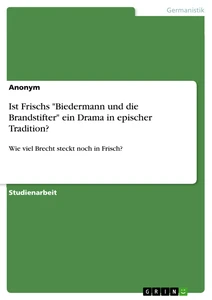



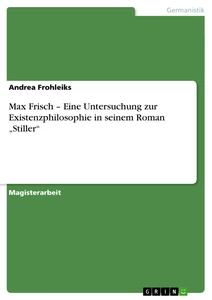
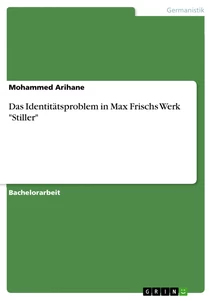
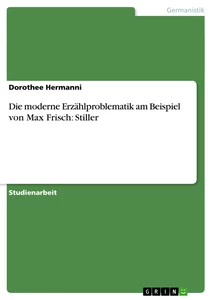





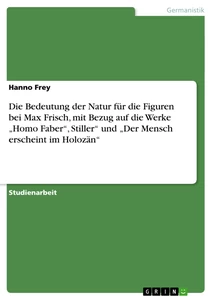

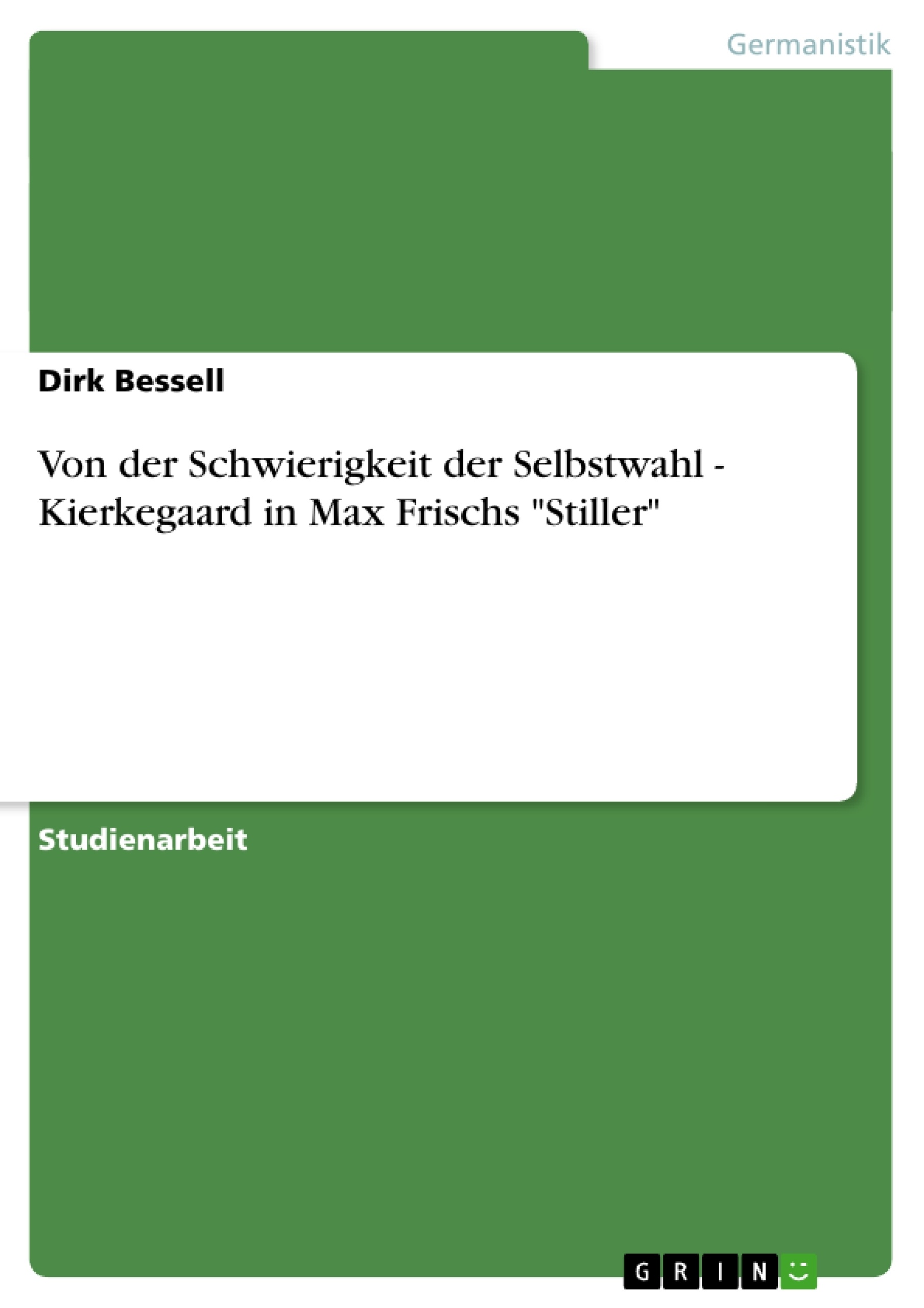

Kommentare