Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Ritterideologie Kaiser Maximilians I. im „Theuerdank“
2.1 Die Ideologie hinter der Ideologie
2.2 du nennest rittr: waz ist daz?
2.3 „Der letzte Ritter“?
2.4 Ritterrenaissance
3. Gedechtnus
3.1 Die neun Helden
3.2 König Artus als ritterliches Vorbild
3.3 Todesaspekt der Gedechtnus
3.4 Rezipienten
3.5 Der Ritter als höfisches Leitbild
4. Der „Theuerdank“
4.1 Theuerdank-Type
4.2 Gattungsfrage
4.3 Textanalyse
4.4 Historizität
4.5 Struktur
5. Des Heiligen Römischen Reiches oberster Jägermeister
6. Künstlerkreis
6.1 Humanisten
6.2 Andere Künstler und Kunstverständnis
7. Kreuzzug als politisches Leitmotiv
7.1 Kreuzzugsideologie
7.2 Literarischer Kreuzzug
7.3 Propaganda
7.4 Türkenzug-Propaganda
7.5 Ritterorden
8. Das Turnier als Teil der ritterlich-höfischen Kultur
8.1 Das Turnierbuch „Freydal“
8.2 Maximilians Bezug zum Turnier
8.3 Turniere im „Weißkunig“
8.4 Das Turnier im „Theuerdank“
9. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Don Quixote“1, „Letzter Ritter“ oder der „Vater der Landsknechte“ sind Bezeichnungen, die häufig im Zusammenhang mit dem Habsburger Maximilian I. fallen und die komplexe Persönlichkeit des Kaisers zu simplifizieren und kategorisieren versuchen. Dass dies jedoch höchst problematisch ist, merkt man daran, dass jede Aussage für sich genommen falsch ist und bestenfalls einen Aspekt seiner Persönlichkeit beleuchtet. Die negativ konnotierte Referenz auf Cervantes tragikomischen Romanhelden Don Quijote zeichnet das Bild von einem Kaiser, der in einer veränderten Welt einem überkommenen Ideal hinterherjagt. Gemeinsam haben Cervantes Romanfigur und der Theuerdank zwar eine gewisse historische Distanz zum Rittertum2, jedoch bewegt sich Letzterer in einer Umwelt, in der das Rittertum noch aktiver kultureller Bestandteil der Gesellschaft ist, wenn auch in modifizierter Form. Auch der Terminus „Letzter Ritter“ impliziert das Ende des Rittertums, das aber de facto noch bis in die Neuzeit hinein weiterlebte. Die Bezeichnung des Kaisers als „Vater der Landsknechte“ greift einen Aspekt auf, der auf das Interesse Maximilians an der Adaption der Kriegstechniken in einem sich verändernden Umfeld verweist, in dem zugleich aber auch ein gravierender Bedeutungswandel für das Rittertum mitschwingt.
Die Meinungen über Maximilian, der als Sohn Kaiser Friedrichs III. und Eleonore von Portugal 1459 in Wiener Neustadt geboren wurde, gehen weit auseinander. Dies liegt darin begründet, dass der Kaiser ein Mensch mit vielen Facetten war und sich das Maximilianbild im Laufe der Jahrhunderte stetig wandelte. Schmidt-von Rhein entwirft ein zeitgenössisches Psychogramm:
„Dem sich selbst verherrlichenden Ritter standen das schillernde Bild einer Persönlichkeit gegenüber, die zwar volksnah, gutmütig und verschwenderisch, aber auch unausgewogen, wankelmütig und grausam sein konnte. Unzuverlässigkeiten, Vertragsbrüche, Scheinbündnisse und Verstellungskünste waren ihm nicht fremd. Aus persönlichen und emotionalen Gründen, wie beispielsweise seiner Jagdleidenschaft, der er besonders gern in Tirol und Schwaben nachging, konnte er sogar wichtige politische Entscheidungen zurückstellen oder verdrängen.“3 Ein auffälliges Charakteristikum Maximilians ist, dass er alle Lebensbereiche dem höfisch-ritterlichen Ideal verschrieb. Zwar bewegte er sich damit im Rahmen eines europäischen Phänomens, an dem sowohl Herrscher als auch Bürger partizipierten, jedoch hatte das Rittertum für den Kaiser einen hohen Stellenwert, wie im Folgenden belegt werden soll. Bestes Beispiel ist hierfür der „Theuerdank“, der sich in die Tradition der Heldenbücher stellt und bei dem Maximilian sogar selbst die Feder ergriff. Dies belegt, mit welchem Einsatz der Kaiser bemüht war, im Gedächtnis seiner Nachkommen als ritterlicher Held bewahrt zu werden.
Bis ins 18. Jahrhundert war das Heldenbuch des Kaisers ein beliebtes Werk und konnte auf eine 200-jährige Rezeptionsphase zurückblicken. Nach dem emphatischen Beifall Anastasius‘ Grün in seinem „Romanzenkranz“ wurde der „Theuerdank“ in der Literaturwissenschaft des 19. Jahrhunderts überwiegend stiefmütterlich behandelt. Die kritische Beurteilung resultierte aus der strukturellen Schwäche des Werkes, in dem sich durch die schematische und variantenarme Aneinanderreihung von geferlicheiten eine gewisse Monotonie einstellt.4 Besonders August Vilmar disqualifizierte den „Theuerdank“ aufgrund seiner mangelnden Poetizität und beendete seine Textanalyse mit einem vernichtenden Schlusswort: „Jetzt ruhet der Theuerdank im Staube der Bibliotheken, wie der edle Maximilian in dem Moder seiner Kaisergruft. Laßen wir sie ruhen, den großen Kaiser und sein kleines Buch.“5 Aber auch die politisch-strukturellen Probleme des Reiches führten im 19. Jahrhundert dazu, dass man den Beginn des Zerfalls in der Regierungszeit Maximilians ansetzte und demzufolge ein negatives Bild von dem Kaiser hatte.6 Die preußisch-österreichischen Rivalitäten des 19. Jahrhunderts sorgten für zusätzliche kontroverse Debatten über den Habsburger.7 Besonders Ulmann führte einen regelrechten Feldzug gegen den Kaiser, der in Maximilian einen unberechenbaren Herrscher machiavellistischer Manier sah, der seine hauspolitischen Interessen vor die Interessen des Reiches stellte und sich den fortschrittlichen nationalstaatlichen Tendenzen widersetzte.8 Wiesflecker sieht die Ursache für ein Umdenken in Bezug auf den „Kaiser an der Zeitenwende“ im Scheitern des radikalen Nationalismus begründet.9 Sein komplexes Werk, das er nach jahrelangem intensivem Quellenstudium über das Leben des Kaisers angefertigt hat, revidiert nationalistische Meinungen und bietet eine fundierte Grundlage für historisch-analytische Interpretationen. Einen anderen Ansatz verfolgte Müller mit seinen soziologischkulturellen Untersuchungen zur „Gedechtnus“-Ideologie des Kaisers, die sich auf das literarische Erbe fokussieren. Der in jüngster Zeit erschienene Sammelband zur maximilianischen Hofkultur bietet einen breit gefächerten Einblick in das Leben des Kaisers unter literarischen, künstlerischen und dramaturgischen Gesichtspunkten.
Ziel dieser Überlegungen wird es sein, der Frage nachzugehen, warum sich der Kaiser einer Ideologie bediente, die sich um 1500 bereits weit von der ritterlichhöfischen Kultur der Blütezeit entfernt hatte und durch ihren Verlust an Exklusivität für jedermann zugänglich geworden war. Wollte der Herrscher durch die Integration der Ritterkultur in seine Herrscherideologie Nähe zu seinem Volk herstellen, wie von seinen Jagden berichtet wird oder ging es ihm darum das Rittertum in den Dienst einer höheren Idee zu stellen? Im Folgenden sollen die vielfachen Bezugspunkte Maximilians zum Rittertum herausgearbeitet werden und Hintergründe für seine Affinität gefunden werden. Der Fokus dieser Arbeit ist auf das literarische Schaffen des Kaisers gerichtet, welches neben künstlerischen Auftragsarbeiten, integraler Bestandteil seiner Herrschaftsrepräsentation war. Insbesondere der „Theuerdank“ verweist explizit auf die höfische Epik und dient als Transportmittel der kaiserlichen Ritterideologie.
2. Die Ritterideologie Kaiser Maximilians I. im „Theuerdank“
2.1 Die Ideologie hinter der Ideologie
Untersucht werden soll die Ideologie, die Maximilian mithilfe des Rittertums in seinem politischen und literarischen Wirken zu transportieren intendierte. Aber auch die ideologischen Bestandteile des Rittertums an sich, als Ideengemeinschaft, sollen berücksichtigt werden. Allgemein handelt es sich bei einer Ideologie um eine „Lehre von den Ideen“10, sie ist also ein hypothetisches Konstrukt, das gewisse Vorstellungen und Ideen eines einzelnen, einer Gruppe oder eines Systems über sich und die Umwelt beinhaltet.
„Im politischen Sinne dienen Ideologien] zur Begründung und Rechtfertigung politischen Handelns. Ideologien] sind daher immer eine Kombination von [.] bestimmten Weltanschauungen [...], die jeweils eine spezifische Art des Denkens und des Wertsetzens bedingen, und [.] eine Kombination von bestimmten Interessen und Absichten, die i.d.R. eigenen [...] Zielen dienen.“11 Es gestaltet sich schwierig moderne Ideologietheorien auf ein System anzuwenden, das sich auf mittelalterliche Vorstellungen stützt. Um die Ideologie hinter dem kaiserlichen Herrschaftsstil besser analysieren zu können, bietet es sich an, Gramscis Hegemoniebegriff anzuwenden, wobei man ihn losgelöst von gesellschaftspolitischen Umständen auf seine Kernaussage reduzieren muss. Denn die Begriffe Herrscherklasse und Kapital haben in der Übergangsphase vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit noch keine bzw. eine zunächst marginale Funktion. Hegemonie bedeutet bei Gramsci, dass „die herrschende Klasse nicht nur herrscht, sondern auch >führt<, einen weitreichenden Konsens in der Bevölkerung erzeugt.“12 Der Herrscher gibt sich „volkstümlich“13, wie es auch Maximilian gerne tat, um sein Volk von sich einzunehmen. Es birgt aus heutiger Perspektive eine gewisse Problematik zu beurteilen, inwieweit er dabei mit seinen Untertanen sympathisierte - das einschneidende Erlebnis der Gefangennahme in Brügge 1488 hat die Sympathie mit aufständischen Bürgern sicherlich nicht gefördert14 - oder ob er seinen Einfluss durch eine volksnahe Inszenierung stärken wollte. Gramsci postuliert, dass sich mit dem Herrscher „zahlreiche Politiker, Juristen, Kulturschaffende, religiöse Moralisten und andere Intellektuelle (im weiten Sinne)“ verbinden und „die herrschende Ideologie in eine fürs Volk überzeugende Sprache übersetzen.“15 Diese Annahme stimmt insofern überein, dass Maximilian einen Künstlerkreis und angesehene Humanisten um sich scharte, um sie für seine politischen Ziele zu instrumentalisieren und mit ihrer Hilfe Einfluss zu üben. Dass aber zumindest die Humanisten dabei auch eigene Ziele verfolgten, soll im Kap. 6.1 noch näher erläutert werden. Durch die Verbindung von Wort und Bild im Druck, konnte bei politischer Propaganda ein großer Rezipientenkreis angesprochen werden, da der Analphabetismus in einem Großteil der Bevölkerung noch verbreitet war. Mit seinem volkssprachlichen Ruhmeswerk versuchte er aber andere Adressaten anzusprechen. Geschickt nutzte der Kaiser die neuen Medien, um politische Gegner zu diskreditieren und fehlende politische Durchsetzungskraft zu kompensieren. Hintergrund ist die Entwicklung des kaiserlichen Universalimus in Richtung eines „institutionalisierten Dualismus“16, bei dem die Autonomiebestrebungen des fürstlichen Partikularismus eine Konkurrenzsituation herbeiführen.
„Mit seinem universalen Anspruch und religiösen Charakter hatte das Kaisertum auf der Basis der römischen Kaisertradition und der christlichen Vorstellung von göttlicher Einsetzung im weltlichen Bereich eine gleichsam absolute Gewalt und universale Geltung in der Christenheit erlangt“,17 doch die Landesstände hatten bereits seit der Ratifikation der Goldenen Bulle von 1356 eine „herausgehobene verfassungsrechtliche und poltische Position im Reich; dies galt für die Ausübung einstmals königlicher Regalien wie Berg- und Münzrechte ebenso wie für die Gerichtshoheit und die Unteilbarkeit der Kurfürstentümer.“18 Seit der Wahl Maximilians zum Römischen König im Jahre 1486 fanden regelmäßige Reichsversammlungen statt, die sogenannten Reichstage. „Seit damals zeigte sich der Gegensatz zwischen dem genossenschaftlichen Verständnis< der Reichsstände und dem >monarchisch-monistischen Denken< der Kaiser aus dem Hause Habsburg.“19 Während die Stände mehr Mitbestimmung wollten, welche auf dem Augsburger Reichstag von 1500 durch die Machtbeschränkung Maximilians und die Durchsetzung eines quasi ständigen Reichstags vorübergehend ihren Höhepunkt erreicht hatte,20 versuchte der Kaiser seine politischen Interessen - zumeist handelte es sich um Truppenhilfe und finanzielle Unterstützung bei Feldzügen - mehr oder weniger erfolgreich durchzusetzen. „Der Kaiser wurde zwar als Mittelpunkt des Reichslehensverbandes aufgesucht, auch beim Streit mit Nachbarn um Hilfe gebeten, an der Reichspolitik oder gar an den Reichslasten wollte man sichjedoch keinesfalls beteiligen.“21
Um die Komplexität des Ritterbegriffs, der innerhalb von Jahrhunderten einen Bedeutungswandel erfuhr zu veranschaulichen, soll im Folgenden eine skizzenhafte Rekapitulation die wichtigsten Aspekte herausarbeiten, um als Grundlage für die retrospektiven Betrachtungen um 1500zu dienen.
2.2 du nennest rittr: waz ist daz?
Der Terminus Ritter lässt sich nicht eindeutig definieren, da Unklarheit über seine genaue Entstehung besteht und das Rittertum an sich ein soziales Phänomen mit einer jahrhundertelangen Entwicklung ist, das sich nicht eindeutig rekonstruieren lässt. Auf die Polysemie des Terminus weist auch Paravicini hin, der zwischen „Amt, Würde, Stand und Idee“ differenziert. 22 23
Einigkeit besteht in Bezug darauf, dass die verschiedenen Bezeichnungen des Ritters wie zum Beispiel der französische chevalier, der spanische caballero oder der niederländische ridder in direktem Zusammenhang mit dem lateinischen miles stehen. Die Problematik offenbart sich jedoch darin, dass der miles ein reiner Fußsoldat war und mit dem Ritter zu Pferd nicht in Einklang zu bringen ist.24 Es entstand „das Paradoxon des reitenden Fußgängers“.25 Es ist also ersichtlich, dass vom römischen miles zu seinem mittelalterlichen Pendant keine kontinuierliche Entwicklung stattgefunden haben kann.26 Der ritter der frühen Quellen hatte wenig mit dem später überhöhten Ritterbegriff gemeinsam, denn es wurden damit unfreie Krieger bezeichnet, die sich aus allen Bevölkerungsschichten rekrutierten und gegen Bezahlung Kriegsdienst leisteten.27 Die Ritter dienten dem Adel, denn solche „um sich zu scharen, ist ein Zeichen von Macht, aber auch eine Notwendigkeit bei der Erledigung von Aufgaben.“28 Innerhalb des sozial heterogenen Gefüges boten sich Aufstiegsmöglichkeiten, so dass sich das Rittertum im 13. Jahrhundert im niederen Adel positionieren konnte und unfreie Ritter verschwanden.29 Somit war die Entwicklung vom Berufsstand zum Geburtsstand vollzogen, der die soziale Mobilität beschränkte.30 Damit verbunden fand neben der Aufwertung des Rittertitels eine Monopolisierung der adligen Kriegsführung statt.31 Für den Hochadel galt es nunmehr als Makel die Ritterwürde nicht zu besitzen, so dass sich auch Könige zu Rittern schlagen ließen.32 Als alle Stände verbindendes Element fungierten eine spezielle Lebensweise und spezifische Ethik, bei denen Dienst und Herrschaft eine zentrale Rolle spielten.33 Die Attraktivität der Ritterwürde, die durch die Idealisierung in der volkssprachlichen höfischen Epik gefördert wurde,34 resultierte auch aus der öffentlichen Anerkennung als etablierte Lebensform.35 Großen Anteil daran hatte die Akzeptanz der Kirche, die eine grundsätzliche Differenz von christlicher Abstinenzmoral und konventioneller Herrenethik, bei der Erfolg im Kampf prämiert wurde, überbrückt hatte.36 Die ursprünglich miteinander konkurrierenden Moralsysteme näherten sich dadurch an, dass die Kirche die Ritter in ihre Dienste stellte. Politische Bewegungen wie die Kloster- und Kirchenreform, der Investiturstreit sowie die Kreuzzüge erforderten eine erhöhte Gewaltbereitschaft beim Klerus.37 Deshalb versuchte die Kirche das Kriegertum auf christliche Normen und Werte zu verpflichten, um deren Schutz zu Zeiten eines geschwächten Königtums, das dieser Aufgabe nicht nachkommen konnte, zu gewährleisten.38 Der Begriff miles christianus, der zuvor eine Bezeichnung für Mönche war, erfuhr einen Bedeutungswandel und galt nunmehr als Auszeichnung und wirkte sich identitätsstiftend auf das Rittertum aus.39 Aus der Assimilation der zuvor konträren Moralsysteme entwickelte sich eine höfische Ideologie, deren Gegensätze im Zeichen der militia spiritualis vereint wurden, wobei Waffentat und Liebe für das christliche Streben nach Perfektion instrumentalisiert wurden.40 So wie sich das Rittertum vom 3. Stand, den Bauern, abzugrenzen versuchte, entstand nach der Blütezeit des Rittertums im 12. und 13. Jahrhundert41 auch bei dem Hochadel der Wunsch sich von seinen Vasallen abzugrenzen. Er berief sich dabei auf das Privileg der freien Geburt, das ihn vom niederen Adel unterschied.42 Die Ritterschaft, die ihren Namen von dem Erwerb der Ritterwürde ableitete, konstituierte sich nach der geburtsständischen Verfestigung sukzessive aus einer immer geringer werdenden Anzahl von „echten“ Rittern.43 Das bedeutet, dass die Ritterwürde an Bedeutung verlor und bestenfalls noch einen ideellen Wert besaß. „Die Leute nennen sich ritterbürtig, schildbürtig, zum Schild geboren, auch Knappen vom Wappen, (Edel-)Knechte.“44 Verbindend wirkten jedoch die ritterlichen Tugenden, die weiterhin als Teil des adeligen Selbstverständnisses fungierten.45 Neben der Loslösung von einer ständeübergreifenden Ideengemeinschaft, wandelte sich auch die Bedeutung des ritterlichen Status als Kämpfer. Während des 100-jährigen Kriegs, der vom 14. Jahrhundert bis ins 15. Jahrhundert immer wieder zwischen Frankreich und England schwelte, hatten die französischen Ritterheere während der Schlachten bei Crécy (1346), Poitiers (1356) und Azincourt (1415) schwere Niederlagen gegen die englische Armee46, die mit Langbogen antrat und so aus weiter Distanz den Gegnern hohe Verluste beibringen konnte, zu kämpfen. Die veraltete Form des ehrenhaften Zweikampfes verlor zunehmend an Popularität und die Niederlagen wurden mit einem angeblichen Verrat in den eigenen Reihen zu begründen versucht.47 Mit der Nationalisierung des Soldmarktes in Frankreich, England und Italien brach eine wichtige Einnahmequelle der Ritterschaft weg.48 Auch der langsame Umstieg auf Feuerwaffen49 und die Reorganisation des Heerwesens durch den Einsatz von Landsknechten, führte zu einer wachsenden Marginalisierung des Ritterstandes. Zudem markierte der Ewige Landfrieden, der unter Maximilian auf dem Wormser Reichstag 149550 verabschiedet wurde, einen bedeutenden Einschnitt in das ritterliche „Monopol der bewaffneten legalen Gewaltanwendung“,51 dem Fehderecht. Bei Kriminalisierung der Fehde vollzog sich ein Wandel hin zum fürstlichen Gewaltmonopol. Hinzuzufügen ist, dass die Finanzierung der ritterlichen Repräsentation wie beispielsweise bei Turnieren ein Kostenfaktor war, den sich viele niederadelige Ritter nicht leisten konnten.52 Es war für sie nicht einfach ihren Status zu erhalten, da die Einnahmen von vielen Faktoren abhängig waren und ein Absinken in die Bedeutungslosigkeit drohte. Zwar ist es unrichtig von einer Verarmung des Adels zu sprechen, doch „die Grenzen zwischen reichen Bauern und Rittern sind fließend.“53 Es gilt für „große Teile vor allem des niederen Adels, daß die wirtschaftlichen Ressourcen zum Lebensunterhalt kaum ausreichen, geschweige zur Statuswahrung gegenüber dem ökonomisch potenten Stadtbürgertum.“54
2.3 „Der letzte Ritter“?
Das Bild von Maximilian als „letzter Ritter“, das in der Forschungsliteratur häufig herangezogen wird, wurde entscheidend von Anton Alexander Graf von Auersperg (1806-1876) geprägt, der 1829 unter dem Pseudonym Anastasius Grün einen 51 Stücke umfassenden Romanzenkranz veröffentlichte. Die Romanzen, in 3036 Langversen abgefasst, handeln vom „Letzten Ritter“ Maximilian und referieren auf das Leben und literarische Schaffen des Kaisers.55
„Legenden wie die vom „letzten Ritter“ suggerieren einen ein für alle Male fixierten sozialen Typus selbst dort, wo sie seine Auflösung zum Inhalt haben, so als habe sich in Maximilian und einigen wenigen Zeitgenossen „Rittertum“ als Lebensform und - ideal des hochmittelalterlichen Feudaladels in eine verbürgerlichte Welt gerettet.“56 Diese Vorstellung hat ihren Ursprung in den Restaurationstendenzen des 19. Jahrhunderts57. Es handelt sich um 1500 bestenfalls um eine Umstrukturierungsphase des Rittertums, welche im jahrhundertelangen Entwicklungsprozess, bei dem sich das soziale Gefüge den steten gesellschaftlichen Veränderungen anpassen musste, unerlässlich war. Der Terminus ist insofern legitim, dass er die „Hochschätzung der traditionellen ritterlich-höfischen Kultur“58 impliziert. Müller hat das Bild vom „letzten Ritter“ so interpretiert, dass in ihm die Vorstellung von einer Ritterschaft mitschwingt, in der die Mitglieder jenseits von Ständeklauseln egalitär miteinander verbunden sind, ähnlich wie in einem Ritterorden. Es wird das Bild einer utopischen Lebensform entworfen, die in einem vorindustriellen Stadium verhaften bleibt.59
„Unschwer ist darin eine Projektion des frühen Industriezeitalters zu erkennen, das sich auf den Beginn der Prozesse, an denen es selbst leidet, zurückwendet, die „Poesie“ der aus dem Mittelalter überkommenen Lebensverhältnisse entdeckt und sie in der „Prosa“ der anbrechenden Neuzeit mit dem Stigma tragischen, aber schönen Scheitern bezeichnet.“60
Von einem Aussterben des Rittertums bzw. einem Verfall kann um 1500 nicht die Rede sein. Es handelte sich um einen jahrhundertelangen Entwicklungsprozess, bis sich der Ritter in einen Kavalier verwandelte, er seinen Status als privilegierter Krieger gänzlich verlor und nur noch die Erinnerung an ein altes Standes- und Wertesystem verblieb. „Wir beobachten heute nicht nur das allgemeine Absinken dieser Formen, sondern das Verschwinden jeglicher Standeskultur vor dem Hintergrund unbegrenzter sozialer, professioneller und geographischer Mobilität.“61 Dabei ist zu beachten, dass zu keiner Zeit ein klarer Konsens über den Ritter herrschte, da er sich als sozio-kulturelles Phänomen den ständigen Entwicklungen seiner Zeit anpassen musste. Der Terminus ist jedoch insofern legitim, dass er die „Hochschätzung der traditionellen ritterlich-höfischen Kultur“62 impliziert.
2.4 Ritterrenaissance
Das Ideal des höfischen Ritters hatte zur Geburt des Kaisers seinen Zenit längst überschritten. Doch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts fand „eine neue Welle der Rückbesinnung auf Traditionen, eine zweite Ritterrenaissance“63 statt. Strohschneider stellt heraus, dass der Begriff Ritterrenaissance „die Vorstellung von der ,Wiedergeburt‘ eines Zivilisations- und Kunstzusammenhangs, welcher der organologischen Metapher zufolge zuvor ,abgestorben‘ sein muß“64 impliziert. Hieran wird deutlich, dass der Begriff genauso wenig wie die synonym verwendete „Ritterromantik“ zutreffend ist, da die Ritterkultur in ihren Reaktualisierungsperioden nicht untergegangen war.
Speziell am Hofe lebte die Ritterkultur Kultur wieder auf65 und beeinflusste Maximilian. Während man sich, wie bei Wolf beschrieben, an den Höfen nach arturischer Sitte verkleidete und Tafelrunden inszenierte sowie das Turnier auch in bürgerlichen Kreisen zelebrierte66, war auch das Interesse an der ritterlich-höfischen Epik groß. Die mit dem Terminus „Ritterromantik“ deklarierten Texte des 15. und 16. Jahrhunderts zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich auf ein „vorbildliches und verbindliches Vergangenes, nämlich die hochmittelalterliche volkssprachige Literatur sowie die in ihr vermittelten Normen und Werte“67 verweisen. Die Historizität und Vergänglichkeit des ritterlichen Heldenideals wird aufgedeckt und ein kontrapräsentischer Mythos geschaffen, der die Defizite der Gegenwart bewusst macht.68 Aus diesem Grund wird auch das „Herbeizitieren ritterlicher Exempelfiguren“69 populär, das zwar nicht in den Werken Maximilians explizit vorkommt, aber beispielsweise im „Spruch von den Tafelrundern“, der Bestandteil der kaiserlichen Bibliothek war70, praktiziert wird. Das 256 Reimpaarverse umfassende Spruchgedicht, das auf Ende des 15. Jahrhunderts datiert wird, stellt durch die Auflistung von Rittern einen Bezug zur Artusepik und anderen höfischen Romanen her.71 Bezüge zu Maximilian können durch die Verbindung zum Wittelsbacher Hof hergestellt werden, in dessen Umfeld das Spruchgedicht vermutlich von einem unbekannten Verfasser gedichtet wurde.72 „Der Spruch von den Tafelrundem“ stellt „eine Art abbreviierter Summe höfischer Erzählliteratur dar, indem er eine immense Stofflichkeit des präsenten Materials ordnet und auf knappem Raum überschaubar macht.“73 74 Der Prolog referiert bereits auf die Vorbildfunktion, die von den Vertretern des Adels ausgeht. Im Anschluss folgt eine Auflistung von Helden der höfischen Epik mit einer kurzen Charakterisierung, wie beispielsweise der stoltz Wilhalm ovn osterreich, /Aglay sein amey tugentlich, /Ains vil um das annder littn, / Manicher durch in wardt verschnittn14. Es geht hierbei nicht mehr um die Betonung der Vorbildhaftigkeit des einzelnen Helden, sondern um die Vertreter des Ritterstands, die in ihrer Gesamtheit die Idealität des Rittertums repräsentieren. Zugleich ist es aber auch eine Möglichkeit den Fortbestand der Helden der Artuswelt am Übergang zur Neuzeit zu garantieren.75
Dass zwischen der Entstehung des Gedichtes und den zitierten Werken eine größere zeitliche Distanz liegt, wird auch daran ersichtlich, dass bei der Schreibweise der Namen und ihrer Kontextualisierung Fehler nachzuweisen sind.76 Diese Arbeitsweise wird auch bei den kaiserlichen Werken des Gedechtnus-Zyklus deutlich, die sich an Elementen der höfischen Epik bedienen, diese jedoch demontieren und modifiziert in einen neuen Sinnzusammenhang stellen. Insbesondere im „Freydal“ und „Theuerdank“ wird der Rückgriff auf mittelalterliche Ritterideale und ihre Reaktualisierung praktiziert. Die Besonderheit am „Theuerdank“ im Vergleich zu anderen ritteromantischen Texten ist das Einbetten realhistorischer Vorgänge in Form von âventiuren in den Handlungsraum einer kontingenten Alltagswelt.77 In Differenz zur höfischen Epik ist die Erzählung an das kaiserliche Handeln gebunden, so dass „eine andere Funktionsbindung des hiesigen Romans als allein die Panegyrik und Akklamation des einzigartigen Fürsten - also etwajene, Identifikationsangebot und Medium wertorientierter Selbstvergewisserung eines höfisch-aristokratischen Kollektivs zu sein - kaum erkennbar ist.“78
Das Ritterbild wird also in den Dienst der kaiserlichen Panegyrik gestellt und dient der Gedechtnus des Kaisers. Strohschneider stellt die These auf, dass sich Maximilian des traditionellen Erzählmusters der höfischen Epik bediente, weil noch keine aktuellen Projektionsschemata für das adelige Selbstverständnis der Übergangsphase vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit zur Verfügung standen.79 Der Ritter ist Instrument, das zur Verherrlichung kaiserlicher Taten dient und ist somit prinzipiell austauschbar.80 Wenzel geht mit seiner Theorie sogar einen Schritt weiter. Er sieht in dem Rückgriff auf die höfischen Ideale ein Indiz dafür, dass der Kaiser mit dem Bezug auf traditionelle Leitbilder die unsichere Gegenwart sichern wollte.81 Damit verweist er auf die desolate Außen- und Innenpolitische Situation des Reiches zur Regierungszeit Maximilians, gegen die der Kaiser anzukämpfen hatte. Die Gesellschaft befand sich in einer Umschwungsphase mit veralteten Klassifikationsmustern, so dass sich der Kaiser auf alte Ordnungsmuster wie die höfische Epik berufen musste, um eine gewisse Kontinuität und Stabilität zu evozieren, die sich zugleich durch seinen persönlichen Bezug stabilisierend und legitimierend auf seinen Status als Herrscher auswirkte. Das heißt, dass er sich dieser traditionellen Muster bediente, um sich selbst als Bestandteil einer Tradition zu inszenieren und damit für seine Herrscherlegitimation zu sorgen. Dies verkürzt sich auf die Formel: Tradition bürgt für Legitimation. Dies lässt sich auch an seinen genealogischen Untersuchungen belegen, die dafür sorgen sollten, dass das relativ junge und zuvor unbedeutende Geschlecht der Habsburger sich unter den anderen europäischen Adelsgeschlechtern als Herrscherdynastie etablieren sollte.
3. Gedechtnus
In der Forschung wird zur Versinnbildlichung Maximilians Gedechtnus- Programmatik, die den Kaiser als Antriebskraft für sein literarisch-künstlerisches Schaffen diente, vielfach ein Zitat aus dem „Weißkunig“ herangezogen:
Wer Ime in seinem leben kain gedachtnus macht der hat nach seinem todt kain gedaechtnus und desselben menschen wirdt mit dem glockendon vergessen (Weißkunig, p. 69).
Das Ziel des Kaisers ist es also unvergessen zu bleiben, sich unsterblich zu machen. Müller reduziert die Intention hinter der komplexen Gedechtnus-Programmatik auf zwei Aspekte: „(möglichst vollständige) Registrierung des Gedenkwürdigen und seine monumentalisierend-überhöhende Darstellung.“82 Hierfür nimmt er auch gerne einen hohen finanziellen Aufwand für die Umsetzung in Kauf, wie er im Folgenden ausführt: darumb so wirdt das geld so Ich auf die gedechtnus ausgib nit verloren, aber das gelt das erspart wirdt in meiner gedachtnus das ist ain unndertruckung meiner kunftigen gedaechtnus (Weißkunig, p. 69). Derjunge Weißkunig alias Kaiser Maximilian rechtfertigt seine hohen Ausgaben mit seiner Fürstenpflicht, für die eigene und fremde gedechtnus zu sorgen.83
Verdiente Getreue zeichnete der Kaiser dadurch aus, dass er sie an seiner gedechtnus teilhaben ließ. Exemplarisch steht hierfür die Dichterkrönung, die zwar der Erhöhung des Herrschers diente, zugleich aber auch die mit dem Kaiser in Verbindung stehenden Dichter unsterblich machte. Im „Triumphzug“ werden etwa 24 Landsknechtführer mit Namen und Bild festgehalten84 und im „Freydal“ verdiente Turniergegner in einem Namensregister verewigt.
Der Gedechtnuszyklus umfasst neben den künstlerischen Werken „Ehrenpforte“ und „Triumphzug“ das Grabmal sowie die literarische Trilogie „Freydal“, „Theuerdank“ und „Weißkunig“.
„Die Programme der einzelnen literarischen Werke berühren sich sowohl untereinander wie mit dem Programm des Grabmals. So wurde die Genealogie in historisch verbesserter Form in die Ehrenpforte aufgenommen, die politischen Taten des Kaisers finden sich auf ihr wie im Triumphzug, in dem auch die Grabbilder erscheinen und die Heiligen der Sippen- und Magenschaft wurden gleichzeitig mit ihrer Verbreitung durch den Holzschnitt auch in Statuetten für das Grabmal in Erz gegossen.“85
Das Hauptaugenmerk dieser Untersuchungen ist jedoch aufgrund der Komplexität der Thematik auf die literarischen Werke des Kaisers ausgerichtet. Der Weißkunig entstand zwischen 1510 und 151586 unter redaktioneller Anleitung des Kaisers und ist, genauso wie die anderen literarischen und künstlerischen Werke des Gedechtnus- Zyklus mit Ausnahme des „Theuerdank“ Fragment geblieben. Die erste gedruckte Ausgabe erschien erst 1775, also über 250 Jahre nach dem Tod Maximilians.87 Die Lebensbeschreibung des Kaisers in Prosaform, die ähnlich wie der „Theuerdank“ in verschlüsselter Form vom Leben des Habsburgers berichtet, ist in drei Teile untergliedert: Die Elternvorgeschichte, in Analogie zur epischen Tradition des Mittelalters88, wie sie auch beispielsweise bei Gottfrieds „Tristan“ oder Wirnts von Grafenberg „Wigalois“ anzutreffen ist, die Jugend des Weißkunigs sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen des Fürsten. Anders als im „Theuerdank“ agiert der Held hier nicht in der primären Rolle des Ritters, sondern als Herrscher, der eine pädagogische Anleitung für seine Nachkommen geben soll.89
Der Kaiser setzte sich unermüdlich für seine gedechtnus ein, von der er sich ère versprach: Er ist ain Unweiser aller kunfftigen kunigen und fursten, das Sy die kunigclich und furstlich gedaechtnus underhalten und meren, Und diesen weißen kunig Insbesonnderheit in kunftiger gedaechtnus Eren sullen (Weißkunig, p. 69).
Die Tradition der Gedechtnus knüpft an die mittelalterliche memoria-Kultur an. Bei der memoria im sozialen Kontext handelt es sich allgemein formuliert um „das an soziale Gruppen gebundene Gedenken der Lebenden und Toten“.90 Das Lexikon des Mittelalters impliziert bei seiner Definition der memoria den Aspekt der „Überwindung des Todes“91 neben der Intention dem Vergessen durch gedechtnus und Erinnerung entgegenzuwirken. Dies lag auch im Sinne des Kaisers, der sich und seinen Ahnen ein Denkmal setzen wollte. Die Memorialüberlieferung umfasst vielfältige Bereiche schriftlicher und visueller Art sowie Denkmäler, Historiographie und Epik.92 „Schrift, Bild und Figur gelten im Mittelalter als Denkmäler der Vergegenwärtigung, als Memorialfiguren sprechender und handelnder Personen, und in dieser Funktion sind sie für den Raum des Hofes ebenso wie für den Raum der Kirche wirksam geworden“93 Speziell im höfischen Rahmen ist ein komplexes Zusammenwirken von Schrift, Bild und Skulptur im Dienste der memoria erkennbar, so dass Maximilian mit seiner Gedechtnus-Programmatik an eine traditionell höfische Ideologie anknüpfte. Die kaiserliche memoria unterscheidet sich aber insofern von anderen adeligen Bemühungen um Nachruhm, dass er als Autor selbst aktiv daran wirkte.94 Neben dem literarischen Gedechtnus-Zyklus fungierten auch Kaiserporträts, der Kenotaph sowie zahlreiche Bildprojekte und panegyrische Schriften von Künstlern als den Nachruhm des Kaisers unterstützende Medien. Hiermit bewegt er sich in einer Tradition, die der „spezifische] Ausdruck jeder Kultur“95 ist. Insbesondere das Christentum ist eine „»Gedächtnis«- oder »Erinnerungs-Religion«, weil das Gedenken der Heilstaten Gottes Hauptinhalt des Glaubens sind.“96 Nach Augustinus enthält die memoria drei Dimensionen: sie verbindet die Tradition der Vergangenheit mit der Gegenwart, die auf Zukünftiges verweist.97 Seit dem Spätmittelalter entwickelte der Adel eine eigene
Memorialüberlieferung, die den christlichen Aspekt der memoria säkularisierte.98 Auch Maximilian hat diese christliche Vorstellung so umakzentuiert, dass sich die gedechtnus ganz auf seine persönlichen Taten bezieht. Die schriftliche Fixierung der gedechtnus resultiert aus dem Bedürfnis die Habsburgerdynastie und deren Privilegierung vor anderen Adelsgeschlechtern zu legitimieren." Dieser Aspekt verweist auf die Vergangenheitsdimension der memoria. Aber auch im Sinne der höfischen Epik intendierte der Kaiser, auf die Dimension der Zukunft bezogen, den lehrhaften Charakter seiner Werke99 100 in Form eines Fürstenspiegels, der seine Taten den Nachkommen als vorbildhaftes Verhalten präsentieren sollte. Dies belegt auch die spezielle Hervorhebung der Nachkommen Maximilians in den Prologen des „Theuerdanks“ und „Weißkunig“, in denen insbesondere Karl der V. Erwähnung findet.101 102
Als Initiation für seine gedechtnus diente der fehlende Bezug zu Traditionen, wie der „Weißkunig“ Auskunft gibt: Darab Er dann oft ainen vertrieß trueg, Das die menschen der gedaechtnus so wenig acht naemen (Weißkunig, p. 68). Müller stellt jedoch heraus, dass das Interesse des Kaisers sich allein auf dynastisch-genalogische Traditionen bezieht, da derjunge Weißkunig mehr über die Ursprünge der kunigklich undfurstlich geschlecht102 erfahren möchte.
„Der Kern der literarischen Werke, die Maximilian in Auftrag gibt, und der überwiegende Teil derer, die ihm seine lateinischen Hofpoeten widmen, ist „historisch“. Und zwar nicht nur in dem Sinne, daß geschichtliche Ereignisse Hintergrund oder Ausgangspunkt eines Versepos, eines Romans sind, sondern daß die Darstellung von „Geschichte“ ihr Ziel ist, genauer: der historischen Persönlichkeit, die allein „Geschichte“ macht.“103 Müller postuliert: „Gedechtnus meint historische Forschungen, literarische Fassung der Memoiren und beider bildliche Ausstattung.“104 Die Instrumentalisierung von Genealogieforschern wird im „Weißkunig“ anschaulich dargestellt und stellt ein Abbild der Realität dar: Er schicket aus gelert leut, die nichts annders teten, Dann das Sy sich in allen Stifften klostern puechern und bey gelerten leutn erkundigetn alle geschleckt der kunig (Weißkunig, p. 68). Dieses Interesse an herrscherlicher Genealogie wird bereits im 8. Jahrhundert bei den Karolingern in Form des „Liber Historia Francorum“ deutlich.105
„Ursprünglich als Mittel des Klerus zur Verhinderung inzestuöser Nahehen in Gebrauch, vollzog sich schon bald ein Bedeutungswandel, dessen Ergebnis auch für das Verständnis der genealogischen Forschungen Maximilians grundlegend ist: Die Genealogie des eigenen Hauses diente bei Eheschließungen dem Nachweis der Ebenbürtigkeit und konnte damit eine wichtige Grundlage dynastischer Heirats- und Territorialpolitik werden, die nachmals auch Erbansprüche zu begründen half.“106
[...]
1 Strohschneider zitiert Franz Grillparzer, in: Ritterromantische Versepik im ausgehenden Mittelalter. Studien zu einer funktionsgeschichtlichen Textinterpretation der »Mörin« Hermanns von Peter Sachsenheim sowie zu Ulrich Fuetrers »Persibein« und Maximilians I. »Teuerdank«, S. 391.
2 Vgl. ebd.
3 Georg Schmidt-von Rhein: Maximilian aus der Sicht der Zeitgenossen, S. 290.
4 Vgl. Hans-Joachim Ziegeler: Der Betrachtende Leser. - Zum Verhältnis von Text und Illustration in KaiserMaximilians I. ,Teuerdank‘, S. 68.
5 Ebd., S. 69.
6 Vgl. Hermann Wiesflecker: Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit. Jugend, burgundisches Erbe und Römisches Königtum bis zur Alleinherrschaft 14591493, S. 15.
7 Vgl. Wiesflecker: Kaiser Maximilian I.. Seine Persönlichkeit und Politik, S. 1.
8 Vgl. Wiesflecker: Kaiser Maximilian I.. Seine Persönlichkeit und Politik, S. 1.
9 Vgl. ebd., S. 2
10 Duden: Fremdwörterbuch, Ideologie, S. 436.
11 Politiklexikon: Ideologie, S. 140.
12 Jan Rehmann: Einführung in die Ideologietheorie, S. 10.
13 Vgl. Hermann Wiesflecker: Kaiser Maximilian I.. Bd.1: Jugend, burgundisches Erbe und RömischesKönigtumbiszur Alleinherrschaft. 1459-1493,S. 11.
14 Vgl. Wiesflecker: Bd. 1, S. 207ff.
15 Beide: Rehmann: Ideologietheorie, S. 10.
16 Alfred Kohler: Expansion undHegemonie. InternationaleBeziehungen 1450-1559, S. 169.
17 Ebd., S. 161.
18 Ebd., S. 166.
19 Alfred Kohler: Expansion undHegemonie, S. 169.
20 Vgl. Hermann Wiesflecker: Kaiser Maximilian I. Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zurNeuzeit. Bd. 3: Auf der Höhe des Lebens. 1500-1508. Der große Systemwechsel. Politischer Wiederaufstieg, S. 1.
21 Ebd., S. 165.
22 Wolfram von Eschenbach: Parzival, 3. Buch, V 3650.
23 Werner Paravicini: Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, S. 3.
24 Vgl. Karl-Heinz Göttert: Der Ritter, S. 16f.
25 Ebd., S. 17.
26 Paravicini: Ritterlich-höfische Kultur, S. 3.
27 Vgl. ebd.
28 Karl-Heinz Göttert: Die Ritter, S. 17.
29 Vgl. ebd.
30 Vgl. Werner Hechberger: Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter, S. 32.
31 Vgl. Johanna Maria van Winter: Rittertum. Ideal und Wirklichkeit, S. 33u. Hechberger, S. 24.
32 Vgl. Paravicini: Ritterlich-höfische Kultur, S. 4.
33 Vgl. Hechberger: Adel, Ministerialität und Rittertum S. 34.
34 Vgl. Göttert: Ritter S. 190.
35 Vgl. Horst Wenzel: Höfische Geschichte. Literarische Tradition und Gegenwartsdeutung in den volkssprachigen Chroniken des hohen und Späten Mittelalters, S.15.
36 Vgl. ebd., S. 14.
37 Vgl. Wenzel: Höfische Geschichte, S.14.
38 Vgl. Hechberger: Adel, Ministerialität und Rittertum, S. 35. sowie Winter: Rittertum, S. 48.
39 Vgl. ebd., Winter: Rittertum, S. 64.
40 Vgl. Wenzel: Höfische Geschichte, S. 15.
41 Vgl. Hechberger: Adel, Ministerialitätund Rittertum, S. 36.
42 Vgl. Paravicini: Ritterlich-höfische Kultur, S. 4.
43 Vgl. ebd.
44 Ebd.
45 Vgl. Hechberger: Adel, Ministerialität und Rittertum, S. 37.
46 Vgl. Winter: Rittertum, S. 29.
47 Vgl. ebd., S. 30.
48 Vgl. Paravicini: Ritterlich-höfische Kultur, S. 41.
49 Vgl. ebd.
50 Vgl. Wiesflecker: Hermann Wiesflecker: Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, Bd. 5: Der Kaiser und seine Umwelt, Hof, Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, S. 130.
51 Paravicini: Ritterlich-höfische Kultur, S.21.
52 Vgl. Ebd., S. 44.
53 Otto Borst: Alltagsleben im Mittelalter, S. 66.
54 Jan-Dirk Müller: Gedechtnus. Literatur und Hofgesellschaft um Maximilian I., S. 29.
55 Vgl. Wolfgang Beutin: „Der Kunst erhobst du wieder den halbverfallnen Altar.“ Anastasius Grüns Romanzenkranz „Der letzte Ritter“(1829), S. 425 u. 427.
56 Müller: Gedechtnus, S. 27.
57 Vgl. Paravicini: Ritterlich-höfische Kultur, S. 108.
58 Ebd., S. 109.
59 Vgl. Müller: Gedechtnus, S.213.
60 Ebd.
61 Paravicini: Ritterlich-höfische Kultur, S. 56.
62 Ebd., S. 109.
63 Ebd., S. 44.
64 Peter Strohschneider: „Lebt Artus noch zuo Karydol, So sünd es in der welte baß.“ Von der Aktualität des Vergangenen in höfischer Versepik des ausgehenden Mittelalters, S.71.
65 Vgl. ebd.
66 Vgl. Jürgen Wolf: Auf der Suche nach König Artus, S. 91ff.
67 Vgl. Strohschneider: Ritterromantische Versepik, S. 3.
68 Vgl. Strohschneider: Lebt Artus noch zuo Karydol, S. 70.
69 Vgl. ebd., S.71.
70 Hermann Menhardt: Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, Bd. 2, S. 1159.
71 Vgl. VL, Bd. 9, Sp. 188.
72 Vgl. ebd., Sp. 189.
73 VL, Bd. 9, Sp. 190.
74 Hermann Menhardt: Ein Spruch von den Tafelrundern, V. 191ff.
75 Vgl. Strohschneider: Lebt Artus noch zuo Karydol, S. 71.
76 Vgl. Menhardt: Ein Spruch von den Tafelrundern., S. 153ff.
77 Vgl. Strohschneider: Lebt Artus noch zuo Karydol, S. 90.
78 Ebd., S. 80.
79 Vgl. ebd., S. 61.
80 Vgl. ebd.
81 Vgl. Horst Wenzel: Höfische Geschichte. Literarische Tradition und Gegenwartsdeutung in den volkssprachigen Chroniken des hohen und späten Mittelalters, S. 318.
82 Jan-Dirk Müller: Literatur und Kunst unter Maximilian I., S. 145.
83 Vgl. Müller: Gedechtnus, S.81.
84 Vgl. Thomas Ulrich Schauerte: Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I., S. 38.
85 Ludwig Baldass: Der Künstlerkreis Kaiser Maximilians, S. 17.
86 Christa-Maria Dreißiger: Kommentar zum Weiß Kunig, S.1.
87 Vgl. ebd.
88 Vgl. Harald Tersch: Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, S. 128.
89 Vgl. ebd., S. 128f.
90 Otto Gerhard Oexle: Die Memoria Heinrichs des Löwen, S. 129.
91 LMA, Bd. 6, Sp. 510.
92 Vgl. ebd., Sp. 510.
93 Horst Wenzel: Hören und Sehen, Schrift und Bild: Kultur und Gedächtnis im Mittelalter, S. 323.
94 Vgl. Stephan Füssel: Kaiser Maximilian und die Medien seiner Zeit. Der Theuerdank von 1517. Eine kulturhistorische Einführung, S.8.
95 LMA, Bd. 6, Sp. 510.
96 Ebd., Sp. 510f.
97 Vgl. ebd., Sp. 511.
98 Vgl. ebd., Sp. 512.
99 Vgl. Müller: Gedechtnus, S.81.
100 Vgl.LMA, Bd. 6, Sp. 511.
101 Vgl. Tersch: Österreichische Selbstzeugnisse, S. 119.
102 Vgl. Müller: Gedechtnus, S. 80.
103 Ebd., S. 80.
104 Ebd.
105 Vgl. Schauerte: Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I., S. 117.
106 Ebd., S.117f
- Arbeit zitieren
- Anna-Franziska Hof (Autor:in), 2011, Die Ritterideologie Kaiser Maximilians I. im "Theuerdank", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183510
Kostenlos Autor werden





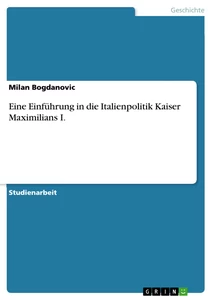




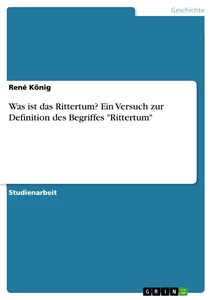


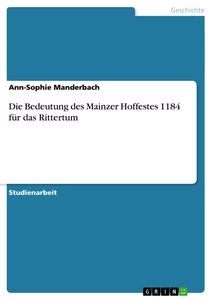
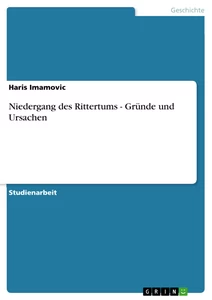

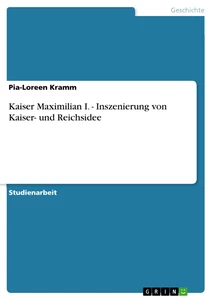


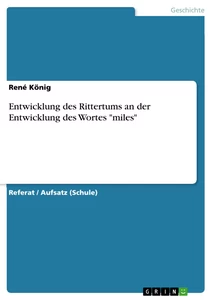
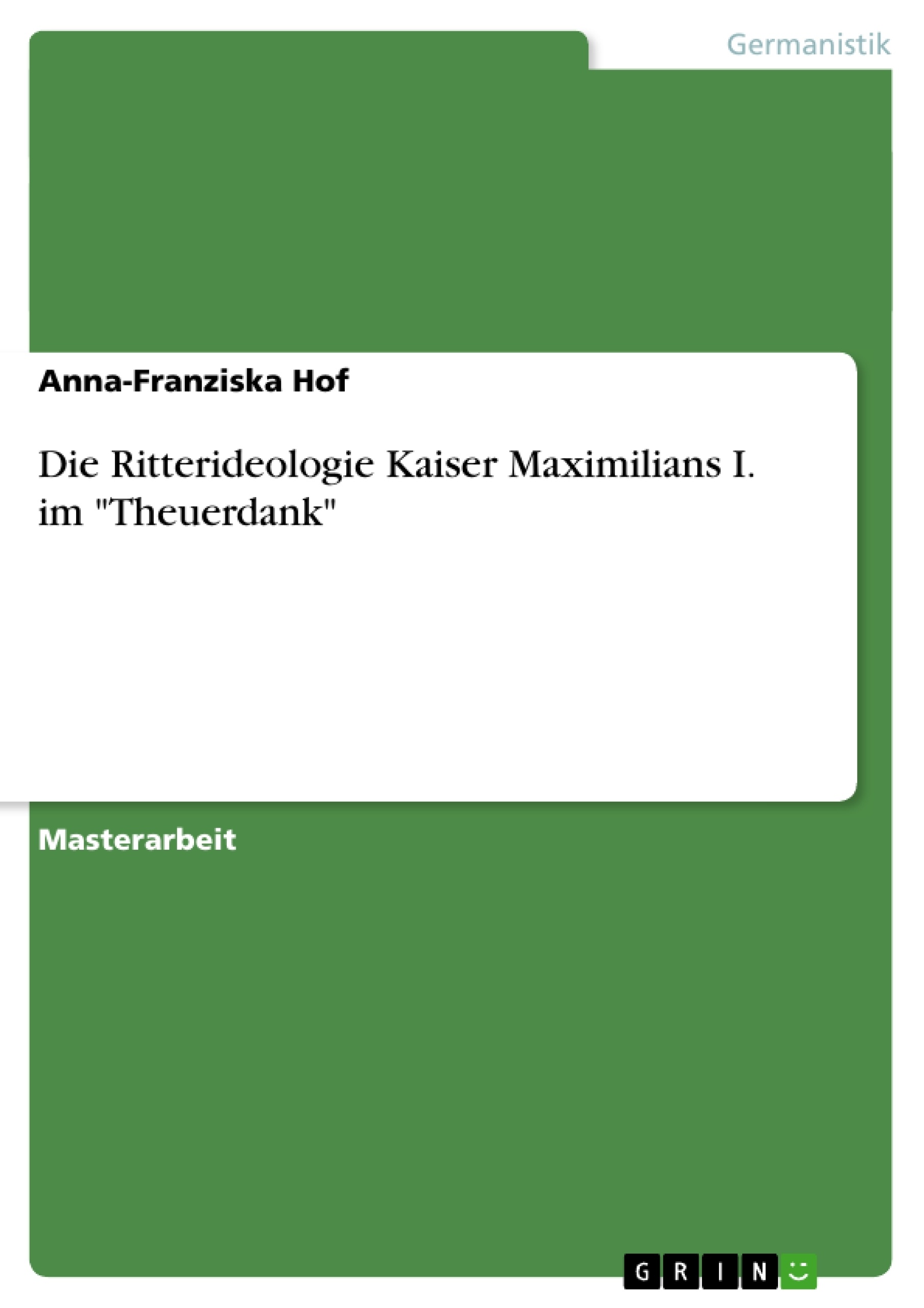

Kommentare