Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Vorrede
2.1 Der „Dreiklang“ der Welt: Religion – Dichtung – Wissenschaft
2.1.1. Religion
2.1.2 Wissenschaft
2.1.3 Dichtung
2.2 Stifters Auffassung von „Groß“ und „Klein“
2.2.1 „Großes“ und „Kleines“ in der Natur
2.2.2 „Großes“ und „Kleines“ im menschlichen Leben
2.3 Das „sanfte Gesetz“
3. Geborgen im „sanften Gesetz“: „Granit“
3.1 Die „Chronik der Pest“
3.2 Die Geschichte des Pechbrennerjungen
3.3 Die Rahmengeschichte
3.4 Die Journalfassung „Die Pechbrenner“
4. Schlussbemerkung
5. Literatur
1. Einleitung
Adalbert Stifters Vorrede zu „Bunte Steine“ gehört mit zu seinen bekanntesten Texten. Doch obwohl das darin auftauchende und erstmals explizit beschriebene „sanfte Gesetz“ immer wieder von Stifters Interpreten in den unterschiedlichsten Zusammenhängen genannt wird, ist die Forschungsliteratur, die sich dezidiert mit der Vorrede auseinandersetzt, dünn gesät. Bei genauerer Betrachtung der Texte, die sich der Vorrede angenommen haben, fällt bald ein Umstand auf, der Ausgangspunkt dieser Arbeit sein soll: Um Gegenbeispiele oder Bestätigung für Stifters Programm zu finden, bezieht man sich auffällig selten auf Erzählungen der „Bunten Steine“. Stattdessen scheint Stifters sonstiges Schaffen wesentlich geeigneter zu sein. Laufhütte offenbart Leerstellen in Stifters Argumentation anhand von „Brigitta“[1], Doppler verfährt ähnlich mit Erzählungen aus den „Studien“[2], Tielke verortet in der Vorrede das „Programm des ‚Nachsommer‘“, das „nicht mehr zu den ‚Bunten Steinen‘ paßt“[3]. Eine Einschätzung, die einigermaßen überrascht, wenn man eindeutige Bezüge innerhalb der Erzählungen der „Bunten Steine“ entdeckt. Wenn Stifter zu Beginn von „Turmalin“ ankündigt, zu enthüllen „wie weit der Mensch kömmt, wenn er das Licht der Vernunft trübt, die Dinge nicht mehr versteht, von dem inneren Gesetze, das ihn unabwendbar zu dem Rechten führt, läßt, sich unbedingt der Innigkeit seiner Freunden und Schmerzen hingibt“[4], ist dieser Passus ohne die ausgefeilten Gedanken der Vorrede kaum verständlich – und bezeichnenderweise in der zugrundeliegenden Journalfassung nicht zu finden. Natürlich kann eine Hausarbeit sich nicht ausführlich mit Vorrede und allen Erzählungen der „Bunten Steine“ auseinandersetzen. Ich werde mich deshalb auf „Granit“ beschränken. Auch die zugrundeliegende Journalfassung soll hierbei auf Unterschiede geprüft werden, bei denen ein Zusammenhang mit den Forderungen der Vorrede plausibel erscheint.
2. Die Vorrede
Um Erzählungen der „Bunten Steine“ unter dem Aspekt der Vorrede zu betrachten, ist es sinnvoll, einzelne Gesichtspunkte derselben gesondert herauszuarbeiten. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, am Ende einige Erwartungen formulieren zu können, mit denen „Granit“ konfrontiert werden kann. Erfüllung oder eben Enttäuschung dieser Erwartungen können damit klar dargestellt werden und möglicherweise auch helfen, einige Aspekte der Vorrede besser zu verstehen, Leerstellen und Widersprüche klarer zu erkennen. Um diese Erwartungen nicht ausufern zu lassen, sollen die zahllosen Quellen und Anregungen, die hinter der Vorrede stehen, bewusst ausgeschlossen werden.
2.1 Der „Dreiklang“ der Welt: Religion – Dichtung – Wissenschaft
Betrachtet man Stifters Vorrede zum ersten mal genauer, erscheint sie als zweierlei: Zum einen als ein gewaltiger Analogisierungsprozeß, der letzten Endes vor allem darauf hinausläuft, Naturgesetzlichkeiten auf menschliches Verhalten zu übertragen. Zum anderen ist die Vorrede Verteidigung des eigenen künstlerischen Schaffens. Um beides herleiten zu können, greift Stifter nicht zufällig auf die drei Disziplinen Religion, Wissenschaft und Dichtung zurück. Es lohnt sich, die Beschreibung dieser Kategorien sowie ihre Verzahnung ineinander genauer zu betrachten. Tut man dies, fällt bald auf, dass „Dichtung“ quasi in den Mittelpunkt gehört, denn sie ist der eigentliche Grund, warum „Religion“ und „Wissenschaft“ überhaupt genannt werden. Beide dienen als Bezugspunkte, welche die Qualität der Dichtung, ihre Funktion und ihre Vorgehensweise beschreiben.
2.1.1. Religion
Die Religion tritt uns in Stifters Vorrede als „das Höchste auf Erden“[5] entgegen. Die Frage, warum sie dieses „Höchste“ ist, kommt hierbei gar nicht auf. Eine Antwort lässt sich bestenfalls erahnen. Wenn Stifter angibt, dass „Gott also die Freude und die Glückseligkeit des Forschens unversieglich gemacht hat“[6], damit also das Bild des allmächtigen, gütigen Schöpfergottes entstehen lässt, der Bewunderung, Verehrung und Anbetung fast zwangsläufig „verdient“, wird die positve Einschätzung der Religion plausibel. Wichtig scheint vor allem, überhaupt ein „Höchstes“ zu haben, um damit den natürlich ebenfalls hohen Wert der direkt nach der Religion kommenden „Dichtung“ zu verdeutlichen. Zudem bietet die Nennung der Religion und die Beschreibung ihres außerordentlichen Wertes Vorlage für die erste der zahlreichen Analogien des Textes:
„Dichter gibt es sehr wenige auf der Welt, sie sind die hohen Priester, sie sind die Wohltäter des menschlichen Geschlechtes; falsche Propheten aber gibt es sehr viele.“[7]
Der Schriftsteller, der „wahre Dichter“, wird in den Rang des Verkünders einer transzendenten Wirklichkeit und Wahrheit erhoben. Dass „gerade der Zusammenhang von Kunst und Religion hergestellt wird“[8] bleibt kein Einzelfall. Die „messianische Funktion“ wird verstärkt hervorgehoben durch die Aussage, dass „ die Kunst und Religion zu dem einfach Hohen und Himmlischen leitet“[9]. Auch wenn Stifters Religionsbild nur vage ausdifferenziert bleibt, wird zumindest angedeutet, dass es - wie falsche Dichtung auch - falsche Religion gibt, die dann zustandekommt wenn „das Innere zur bloßen Gestalt oder zur üppigen Schwärmerei“[10] verkommt. Aus dem Wenigen, was Stifter über die Religion sagt, lässt sich eine erste Erwartungshaltung an die Erzählung formulieren: Wenn Religion thematisiert wird, müsste ihre hohe Werthaftigkeit zu erkennen sein.
2.1.2 Wissenschaft
Konkreter und ausführlicher wird Stifter, wenn es um die Wissenschaft geht. Wenig verwunderlich, da die Wissenschaft ihm nicht den Wert der Dichtung konkretisieren hilft, sondern die Methode, Sinn und Zweck seiner Schriften darlegen soll. Was ist nun Wissenschaft für Stifter, wie arbeitet sie? Zum einen, das zeigt das bereits angeführte Zitat[11], kommt Wissenschaft nie zu einem endgültigen Ziel. Sie ist eine „ewig gestellte, mit äußerstem Ernst zu betreibende, aber unvollendbare Aufgabe“[12], die nur in winzigen Schritten vorwärtskommt, „Beobachtung nach Beobachtung macht“ und damit „nur aus Einzelnem das Allgemeine“[13] zusammenträgt. Während die spektakulären Erscheinungen „den Blick des Unkundigen und Unaufmerksamen mehr an sich“ reißen, enthält sich der Wissenschaftler der Bewertung, da „der Geisteszug des Forschers vorzüglich auf das Ganze und Allgemeine geht“[14] und damit auch dem Unauffälligen mit – vielleicht sogar größerem – Interesse begegnet. Stifter illustriert sein Bild der Wissenschaft mit einem bedacht gewählten Beispiel:
„Wenn ein Mann durch Jahre hindurch die Magnetnadel, deren eine Spitze Spitze immer nach Norden weist, tagtäglich zu festgesetzen Stunden beobachtete, und sich die Veränderungen, wie die Nadel bald mehr, bald weniger klar nach Norden zeigt, in einem Buche schriebe, so würde gewiß ein Unkundiger dieses Beginnen für ein kleines und für Spielerei ansehen; aber wie ehrfurchterregend wird dieses Kleine, und wie begeisterungserweckend diese Spielerei, wenn wir nun erfahren, daß diese Beobachtung wirklich auf dem ganzen Erdboden angestellt werden, und daß aus den daraus zusammengestellten Tafeln ersichtlich wird, daß manche kleine Veränderung an der Magnetnadel oft auf allen Punkten der Erde gleichzeitig und in gleichem Maße vor sich gehen, daß also ein magnetisches Gewitter über die ganze Erde geht, daß die ganze Erdoberfläche gleichzeitig gleichsam ein magnetisches Schauern empfindet.“[15]
Wissenschaft, so geht aus diesem Beispiel hervor, ist also stetes, wiederholtes Beobachten, auch des Kleinen, wenig Aufsehenerregenden. Bevor man den dann überraschenden Schluss aus diesen Beobachtungen ziehen kann, erscheint das Vorgehen selbst fast als vielleicht liebenswürdige, jedenfalls sinnlose Marotte. „Man muß genau hinsehen bei Stifters scheinbaren Harmlosigkeiten“[16], und zu einer dieser scheinbaren Harmlosigkeiten wird dieses Beispiel, wenn man betrachtet, dass Stifter Dichtung und Dichter immer wieder mit Wissenschaft und Forschern in Verbindung bringt. So ist es kein Zufall, dass Stifter mit seinem Schaffen auch „ein Körnlein Gutes zum Baue des Ewigen“[17] beitragen möchte und das Bild des kleinen Kornes im bereits zitierten[18] Passus über die Wissenschaft wieder aufnimmt. Auch das Bild des Forschers als Sammler und Aufzeichner von Beobachtungen wird von Stifter wieder aufgenommen und auf sich selbst bezogen, der „in der Geschichte des menschlichen Geschlechtes so manche Erfahrung zu sammeln bemüht“ gewesen ist, die er „zu dichtenden Versuchen zusammengestellt“[19] hat. Nimmt man diese Analogie von Dichter und Wissenschaftler ernst, erlangt das o.g. Beispiel auch Bedeutung für Stifters Dichtung und deren Beurteilung. Der harsche Kritiker – wie beispielsweise der im Zusammenhang mit Stifters Vorrede immer wieder herangezogene Hebbel – wird dann zum Unkundigen, der sich bei seinen Beurteilungen bei den Einzelteilen der Dichtung aufhält, diese dementsprechend für unsinnige Kleinigkeiten hält, weil er das sinnvolle Ganze nicht zu erkennen vermag.
Folgende Erwartung soll nun aus dem über die Wissenschaft gesagten formuliert werden: Wissenschaft oder auch Forschung im weiteren Sinne vom Erkennen und Erstellen von Zusammenhängen aus Wahrnehmungen müsste sich auch in Stifters Erzählungen durch sich stetig wiederholendes Beobachten vollziehen.
[...]
[1] Vgl. Hartmut Laufhütte, Das sanfte Gesetz und der Abgrund. Zu den Grundlagen der Stifterschen Dichtung ‚aus dem Geiste der Naturwissenschaft‘. In: Walter Hettche u.a. (Hrsg.), Stifter Studien. Ein Festgeschenk für Wolfgang Frühwald zum 65. Geburtstag. Tübingen 2000. S. 61 – 74.
[2] Vgl. Alfred Doppler, Schrecklich Schöne Welt? Stifters fragwürdige Analogie von Natur und Sittengesetz. Robert Duhamel (Hrsg.), Adalbert Stifters schrecklich schöne Welt. Beiträge des Internationalen Kolloqiums zur A.-Stifter-Ausstellung (Universität Antwerpen 1993). Bonn 1994. S. 9 –15.
[3] Martin Tielke, Sanftes Gesetz und Historische Notwendigkeit. Adalbert Stifter zwischen Restauration und Revolution. Frankfurt a. M. 1979. S. 114.
[4] Adalbert Stifter, Turmalin. In: (ders.), Bunte Steine. Stuttgart 1994. S.126.
[5] Adalbert Stifter, Vorrede zu „Bunte Steine“. In: (wie Anm. 4). S. 7.
[6] Ebd., S. 9.
[7] Ebd., S. 7.
[8] Hartmut Laufhütte, Das sanfte Gesetz und der Abgrund (wie Anm. 1). S. 64.
[9] Adalbert Stifter, Vorrede zu „Bunte Steine“ (wie Anm. 5). S. 13.
[10] Ebd.
[11] s. Anm. 6.
[12] Hartmut Laufhütte, Das sanfte Gesetz und der Abgrund (wie Anm. 1). S. 68.
[13] Adalbert Stifter, Vorrede zu „Bunte Steine“ (wie Anm. 5). S. 9.
[14] Ebd., S. 8.
[15] Ebd., S. 8 ff.
[16] Hartmut Laufhütte, Das sanfte Gesetz und der Abgrund (wie Anm. 1). S. 64.
[17] Adalbert Stifter, Vorrede zu „Bunte Steine“ (wie Anm. 5). S. 7.
[18] S. Zitat 8.
[19] Adalbert Stifter, Vorrede zu „Bunte Steine“ (wie Anm. 5). S. 14.
- Arbeit zitieren
- Mario Fesler (Autor:in), 2003, Adalbert Stifters Granit gelesen unter den Prämissen der Vorrede zu Bunte Steine, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22046
Kostenlos Autor werden

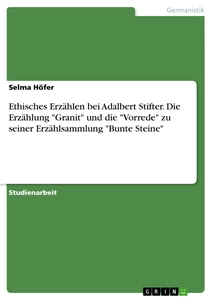
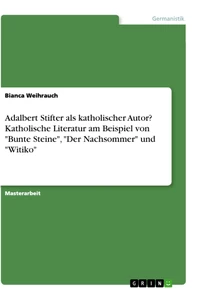
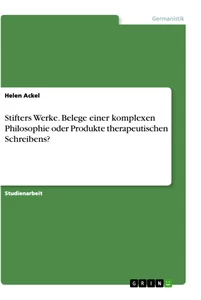

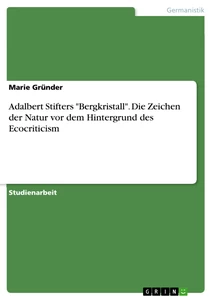
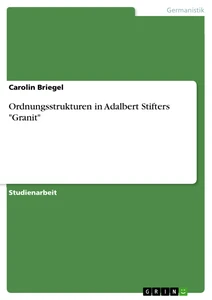
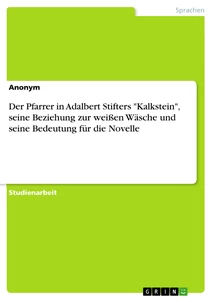





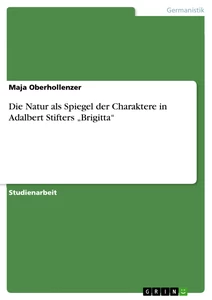

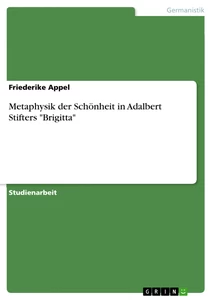
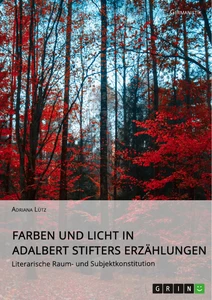
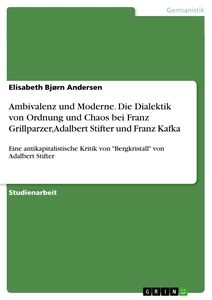


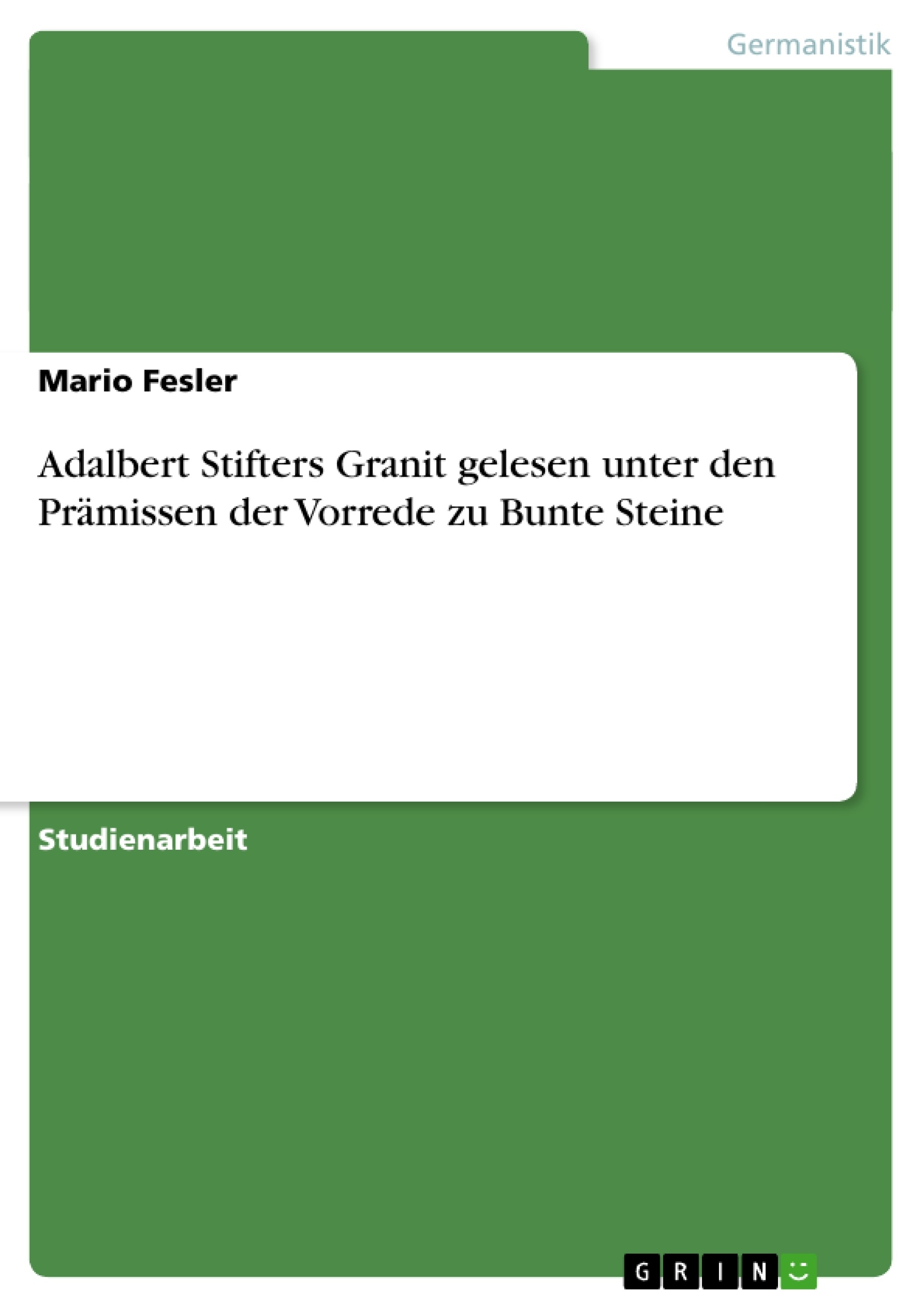

Kommentare