Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung
2 Die Stadt und der Raum in der Literatur
2.1 Mahler
3 Modelle
3.1 Deixis
3.2 Lotmans-Modell
3.3 Mahler
4 Geschichtlicher Kontext
5 II ventre di Napoli von Matilde Serao (1884)
5.1 Zwischen Flucht und Heimatliebe
5.2 Die Jahre der Säuberung
5.3 Analyse
5.4 Seraos Textstadtplan
6 Unpaio d’occhiali von Anna Maria Ortese (1953)
6.1 Die Verbannte
6.2 Die Nachkriegsjahre
6.3 Analyse
6.4 Orteses Textstadtplan
7 L’armoniaperduta von Raffaele La Capria (1986)
7.1 Der Rächer
7.2 Vom Kalten Krieg und innerpolitischen Krisen
7.3 Analyse
7.4 La Caprias Textstadtplan
8 Gomorra von Roberto Saviano (2006)
8.1 Globalismus und Kapitalismus
8.2 Zum Leben verurteilt
8.3 Analyse
8.4 Savianos Textstadtplan
9 Fazit
10 Quellenverzeichnis
Kurzfassung
Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist der Vergleich der Stadtdarstellung Neapels in vier Werken aus verschiedenen Epochen. Die Geschichte und die Lage dieses Ortes lassen die Stadt zu einem Ort der Mythen werden. Unter Einbezug dieser, aber vor allem mit der Lektüre von Stadt Bildern von Andreas Mahler (1999), werden die Texte II ventre di Napoli (19061, Un paio d‘occhiali (1953), L’armonia perduta (1986) und Gomorra (2006) analysiert. Diese Werke verbinden ihre negativen Realitätsmodelle der Stadt. Trotz ihrer Ähnlichkeit in Hinblick auf die negative Stimmung in den Werken stellen sie vier ganz unterschiedliche Zugänge zur Stadtdarstellung dar. Weil alle Werke realistische Züge beziehungsweise autobiographische Elemente enthalten, werden sowohl biographische Hintergründe der Autoren als auch geschichtliche Details berücksichtigt. Des Weiteren werden intertextuelle Gemeinsamkeiten und rekurrierende Modelle analysiert. Im Mittelpunkt stehen nicht die gesellschaftlichen und geschichtlichen Besonderheiten, sondern die literarischen Modelle und die Erzählkunst.
Schlagwörter: Neapel, Literatur, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Statue des Nils
Abbildung 2 Raumdarstellung
Abbildung 3 Via Caracciolo
Abbildung 4 Straßenkinder Neapels 1880 (Richter 2005: 209)
Abbildung 5 Stadtplan von Neapel
Abbildung 6 Textstadtplan Serao
Abbildung 7 Orteses Textstadtplan
Abbildung 8 La Caprias Textstadtplan
Abbildung 9 Savianos Textstadtplan
Die Textstadtpläne und Abbildungen wurden von der Redaktion aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.
Vorwort
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Neapolitanische Küstenstraßen, die zu Buchten mit glasklarem Wasser führen; Pizza; ein kleiner Fiat; eine Strandpromenade mündet in einen großen Hafenabschnitt; Hotels und Eisdielen; Reisen nach Neapel sind ein Mythos, der Inbegriff des mediterranen Lebensgefühls. Frei sein in einer Welt fern ab jeglicher nord- oder mitteleuropäischer Ordnung. Kurz: „La bella vita“. Das prototypische Neapelbild war schon immer geprägt von paradiesischen Elementen. Über viele Jahrhunderte überwog dieses Bild auch in der Kunst und Literatur. Ende des 19. Jahrhunderts begannen jedoch immer mehr Schriftsteller und Künstler auf die Schattenseiten Neapels aufmerksam zu machen. Die Fassade bröckelte. Gegenstand der vorliegenden Diplomarbeit ist eine Analyse des Neapelbildes in der Literatur, dabei werden verschiedene Mythen über die Stadt, die Geographie, die Topographie, aber auch semantische, pragmatische und semiotische Verfahren herangezogen.
1 Einleitung
Was Neapel von anderen Städten unterscheidet? Nea-pel ist reich an Kulturstätten, aber man sieht diese nicht auf den ersten Blick wie etwa in Rom, Venedig oder Florenz, sie liegen im Verborgenen. So wird die Statue des Nils, bekannt durch den Beinamen „Der Körper Neapels“, als Verkaufsstand eines Zeitungs-händlers genutzt.
Walter Benjamin sagte einst: „Dem reisenden Bürger, der bis Rom sich von Kunstwerk zu Kunstwerk wie an einem Staket weitertastet, wird in Neapel nicht wohl“ (Benjamin 1972: 307). In Neapel präsentieren sich Denkmäler ohne jeglichen Glanz, ohne Aura.
Wer in Florenz vor dem Palazzo Strozzi, in Rom vor dem Palazzo Braschi steht, kann sich von einem historisch gebildeten Reiseführer ausmalen lassen, welches bunte Leben sich einst hier abspielte. Wer hingegen in Neapel einen der historischen Paläste wie beispielsweise den barocken Palazzo Serra di Cassano besucht, wird rasch merken, dass die Gegenwart dort noch immer ihren Platz hat: Geschäfte, Au-towerkstätten, Imbissbuden, Verkaufsstände und andere Etablissements sind Bestandtei-le dieser Paläste (Richter 2005: 11-12).
Der Ethnologe Marino Niola (2000: 32) stellte fest, dass die Struktur Neapels als eine Anhäufung unterschiedlichster Zeiten gesehen werden kann. Er bezeichnet dieses Phänomen als „Ansammlung von Zeiten“ und sieht deren Denkmäler und Strukturen „als vielschichtige, unebene Landkarte“, in der Risse und Einprägungen Spuren verschiedener Epochen kennzeichnen. Dieses Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart ist in Neapel allgegenwärtig. In der Nähe der Statue des Nils findet man die Reste des antiken Theaters, in dem einst Kaiser Nero spielte. Das Kunstwerk wurde von einem Hochhaus umbaut, ein antiker Torbogen führt in ein stilloses Bürogebäude mit altem Fahrstuhl. Daneben eine hässliche Garageneinfahrt, unweit davon ein Schild, das auf die antike Stätte aufmerksam macht. Aber nicht nur Alt und Neu liegen in Neapel näher zusammen als in anderen Städten, sondern auch die Toten und die Lebendigen. Die Konstruktion der Stadt auf bröckeligem Tuffstein fördert die Bildung von natürlichen unterirdischen Katakomben und Unterschlüpfen. Diese geologische Gegebenheit wurde von verschiedenen Organisationen zur Erbauung von künstlichen Stollen unter der Erde genutzt. Die Kirche erbaute unterirdische Friedhöfe, die Mafia konstruierte Hinterhalte und Tunnelsysteme. Unter dem Begriff „Unterirdisches Neapel“ wurde hier eine parallele Totenstadt des Untergrunds geschaffen (Richter 2005: 13). Viele Häuser verfügten über 30 bis 40 Meter lange Brunnen, welcher mit dem Stollensystemen in Verbindung standen. Von den Griechen erbaut, von den Spaniern weiterentwickelt, entstand im 17. Jahrhundert das Reich der pozzari, eine unterirdische Welt. In dieser Form blieb jene Stadt unter der Stadt bis zum Bau der Kanalisation 1880 bestehen. Im Zweiten Weltkrieg flüchteten Tausende in die Tiefe. Der Mythos besagt, dass sich in der Umgebung des Vesuv der Eingang zur Hölle befindet (ebd. 14). Laut Richter wurden die Toten bis ins 19. Jahrhundert in den Tunnelsystemen begraben. Diese blieben bis heute bestehen, sind für die Öffentlichkeit aber meist nicht zugänglich.
Neapel ist spannend, mystisch, gefährlich, Neapel ist nicht offensichtlich, Neapel lebt im Verborgenen.
Der Inhalt der vorliegenden Diplomarbeit besteht im Wesentlichen aus einer Analyse der Stadtdarstellung Neapels, wie sie in keiner vergleichbaren Form im deutschsprachigen Raum in der Italianistik gemacht wurde. Anhand von vier Werken aus vier verschiedenen Epochen werden die Stadttexte analysiert und verglichen. Die Stadtdarstellung ab dem 19. Jahrhundert ist sehr interessant, weil Neapel eine starke negative Kon- notation zuteilwird.
Die Stadt als einen Ort der Verdammten, der die Menschen manipuliert, beeinflusst und ihre Empfindungen modifiziert wird vor allem bei den ersten beiden Werken, II ventre di Napoli (1906) von Matilde Serao und Unpaio d‘occhiali (1953) von Anna Maria Or- tese, evident. L’armonia perduta (1999) von Raffaele La Capria befasst sich intensiv mit dem Begriff der napolitanita und kritisiert Anna Maria Orteses Werk. In La Caprias Werk ist die Grundstimmung deutlich besser als in den vorherigen Schriften. Der letzte Roman, der in der Arbeit analysiert wird, ist der Weltbestseller Gomorra - viaggio nell‘impero economico e nel sogno di dominio della camorra.
Die Fragestellung, mit der sich der Hauptteil der Arbeit beschäftigt, lautet: Wie konstituieren sich Stadttexte über Neapel in verschiedenen Epochen und Genres?
Während über Städte wie Paris und London eine Vielzahl von deutschsprachigen und internationalen Schriften zum Thema der Stadtdarstellung existieren, gibt es über Neapel keine vergleichbaren Studien.
In der vorliegenden Arbeit wird ein Auszug von vier Werken in die Fragestellung mit- einbezogen. Es wurde ein Korpus an Werken, die einerseits gemein haben, dass sie allesamt in der realen Geographie verankert sind, andererseits aus unterschiedlichen Genres stammen, ausgewählt. Die Kapitel bauen aufeinander auf. Der theoretische Teil ist deshalb essenziell für die Arbeit, weil ohne ihn kein grundlegendes Verständnis gegeben wäre. Die Theorien der Stadtdarstellung von Mahlers (1999), Scherpe (1990) und Lot- man (1970) bilden die Grundlage der Arbeit. Es wird die Frage „Wie konstituieren sich Stadttexte über Neapel in verschiedenen Epochen und Genres?“ beantwortet.
Ziel der Arbeit ist es, eine literaturwissenschaftliche Reise durchs Neapel der letzten Jahrhunderte darzustellen. Die Analyse beginnt mit dem Jahr der Cholera-Epidemie 1884 und endet im Jahr 2006, als der Roman Gomorra von Roberto Saviano die Welt bestimmter Personen erschütterte. Die Stadt als literarischer Raum steht im Fokus.
Am Anfang erfolgt eine Betrachtung des aktuellen Stands der Forschung, in den folgenden Kapiteln werden Lösungsansatze für die Analyse der Stadt und der geschichtliche Kontext beschrieben.
Im Hauptteil geht es im Wesentlichen um das Lesen der Textstadt Neapel. Die Textdokumente bringen verschiedenste Besonderheiten mit sich, jeder Autor stellt die Stadt anders dar und doch haben die Werke viele Gemeinsamkeiten. Eine einheitliche Anleitung zum Lesen von Stadttexten gibt es nicht. Neapel wird einerseits in Verbindung mit dem Mythos von Sodom und Ghomorra gebracht. Andererseits wird Neapel auch oft paradiesisch beschrieben. War es einst der Mythos, der die Literatur der Stadt bestimmte, kommen heutzutage Nicht-Orte nach Marc Augé wie Shoppingcenter, Autos oder das Internet in den Fokus der Forschung. Die Beschreibung der verfestigten Verhaltensmuster und der mit ihr verbundene kulturelle Aspekt sagen ebenfalls viel über die Stadt und ihre Bewohner aus. Ein Werk spricht zu seinen Lesern und gibt ihnen Hinweise, wie der Text zu lesen ist. Im Hauptteil werden die Werke analysiert, um anschließend im Fazit einen zusammenfassenden Überblick entstehen zu lassen. Die Forschungen von Andreas Mahler zur Stadt in der Literatur bilden dabei die Grundlage aller Ergebnisse. Neben Mahlers Grundlage werden auch andere Autoren wie Lotman und Klotz herangezogen.
An dieser Stelle folgt nun eine Einführung in den Forschungsstand zur Literatur über Neapel, damit man besser sehen kann, wo sich die vorliegende Arbeit positioniert: Zunächst möchte ich mit einer deutschen Dissertation auf dem Gebiet der Romanistik beginnen, die im Laufe der Arbeit immer wieder angeführt wird. Das wissenschaftliche Werk von Sergio Izzo (2009) Neapel sehen und sterben, Zur Darstellung der parthen- opeischen Stadt in der Nachkriegsliteratur, in der er sehr umfangreich über die Neapelliteratur nach dem 2. Weltkrieg schreibt, ist im deutschsprachigen Raum im Bereich der Romanistik ein wichtiges Werk über die Stadt Neapel. Carla Dodi (2010) Villes invisibles de la Méditerranée schreibt ebenfalls über Neapel und andere Städte am Mittelmeer und deren Darstellung in der Literatur. Das französische Werk stellt eine ausführliche Analyse der Stadt anhand von verschiedenen Werken wie Il ventre di Napoli dar. Ernst Bloch (1965) hingegen beschreibt die Porosität der Stadt und sieht sie als Grund für die Geschehnisse und literarischen Schaffungen in der Stadt. Auch Velardi schreibt über die poröse Stadt: „Napoli è porosa come la sua architettura. Porosa nella forma, nei suoi rapporti sociali, nel carattere dei suoi abitanti. L’anima della citta, quindi, non puo esse- re racchiusa in un punto, in un’immagine. Sfugge alle definizioni, è porosa come le sue mura” (Velardi 1992: 10). Von den genannten Werken wird die Arbeit von Izzo am intensivsten in meine Diplomarbeit einfließen, weil sich einige Ansichten und Aspekte in unseren Arbeiten überschneiden.
2 Die Stadt und der Raum in der Literatur
2.1 Mahler
Die Raummodellierung wurde in den letzten zwei Jahrhunderten von verschiedenen Wissenschaftlern erforscht. Diese Vielfalt birgt Probleme und Einteilungsschwierigkeiten, da die Ansätze oft nicht klar definiert werden, Widersprüche beinhalten oder sich gegenseitig widerlegen. Im folgenden Abschnitt wird versucht, die verschiedenen Arbeiten zum Thema nach dem Erscheinungszeitpunkt chronologisch zu gliedern und einen verständlich klaren Überblick entstehen zu lassen. Mit Hilfe dieser Grundlage werde ich im Hauptteil meine Analyse durchführen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Raumdarstellung
Die Stadt ist kein natürlicher Raum, sondern ein künstlicher Ort, der für das Zusammenleben vieler Menschen ausgerichtet wurde und sich durch verschiedene Arten von Institutionen und Infrastruktur vom ländlichen Raum klar abgrenzt. Die Stadt befindet sich immer in Opposition zum ländlichen Raum. Klaus R. Scherpe (1990) meint, dass die Grundlage der Stadtdarstellungen in der Literatur der Mythos ist. Als Referenz gibt er bestehende Mythen, wie die von Babylon, Karthago, Rom, Atlantis und Megalopolis an. Die Literatur beschäftigt sich mit der Frage „Wie arbeitet man am Mythos?“. Entweder greift man bestehende Mythen auf oder bedient sich der Fiktion als Kunstmittel.
Zunächst wird die Frage gestellt, welche Art von Raum für diese Arbeit relevant ist. Der Raumgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Stadt beziehungsweise die Metropole Neapel. Moser unterscheidet zwischen der „Metropole“, einer nicht klar definierten Totalität und der „City“, einem konkreten Raum. Eine Metropole ist ein politisches, ökonomisches oder kulturelles Zentrum eines Landes. Der Begriff wurde abgeleitet vom griechischen metropolis für „Mutterstadt“. Im 19. Jahrhundert etablierten sich Weltstädte als Zentren eines Imperiums (Moser 2005: 11). Eine Metropole ist „der Ort, an dem die Verkehrswege zusammenlaufen, die Institutionen politischer und ökonomischer Macht sich konzentrieren, das kulturelle Leben seinen Brennpunkt findet“ (Moser 2005: 13).
Man unterscheidet zwischen zwei Ebenen von Stadttexten: die Mikro- und die Makroebene. Die Mikroebene beinhaltet semantische Merkmale wie die Deixis und die Refe- rentialisierung. Letztere kann entweder explizit oder implizit erfolgen. Explizit wird eine Stadt oder ein Ort beim Namen genannt, zum Beispiel London, Neapel, Rom. Implizit wird die Stadt mit typischen Merkmalen charakterisiert wie „die Stadt, die niemals schläft“. Werden metonymische Teilreferenzen angeführt, so sind das bekannte Orte, wie zum Beispiel die Freiheitsstatue, das Kolosseum, die Rialtobrücke oder der Hafen. Die Makroebene bildet den Zusammenhang zwischen Genre und Ort und Handlung und Ort.
Die Narratologie beziehungsweise Erzähltheorie beschäftigt sich mit der Untersuchung narrativer Texte und der Erarbeitung von Modellen. Die durchgeführten Recherchen zum Thema Raummodellierung ließen einen Querschnitt der Forschung entstehen. Alle Theorien beschäftigen sich mit den Fragen „Wie wird etwas dargestellt?“ und „Was wird dargestellt?“. Im Kapitel 3 werden Modelle angeführt: die Deixis, die Referentiali- sierung, die Semantisierung und Lotmans Raumsemantik. Ziel ist es dabei, eine Grundlage für die Analyse im Hauptteil zu schaffen (Nünning 2009: 33 - 50).
3 Modelle
3.1 Deixis
Die Deixis ist ein Begriff aus der Pragmatik oder Kontextforschung. Sie beantwortet die Frage, worauf sich ein Satz bezieht. Der Begriff Deixis kommt aus dem Griechischen und bedeutet „hinweisen, zeigen“. Der Ausdruck aus der lexikalischen Bedeutungslehre erklärt die Bezugnahme mithilfe sprachlicher Mittel auf Personen, Zeit und Raum. Dies wird jeweils im Kontext der Ausgangssituation betrachtet. Dieser Kontext steht immer in Verbindung mit dem „deiktischen Zentrum“, der inhaltlichen Kernaussage des Satzes. Das „deiktische Zentrum“ oder Origo zeigt immer auf etwas. Man unterscheidet zwischen Lokal-, Objekt-, Personal-, Temporal- und Textdeixis. Die Lokaldeixis bezieht sich vor allem auf Lokaladverbien wie „hier“ oder „dort“. Die Objektdeixis umfasst Demonstrativpronomen wie „dieser“ und „jener“. Die Personaldeixis bezieht sich mit zum Beispiel „ich“ und „du“ auf die Personen, welche den Sprecher markieren. Die Temporaldeixis bezieht sich auf alle Wörter, die Zeit ausdrücken, so etwa „später“, „nachher“, „zuerst“, „jetzt“. Die Textdeixis hilft zur innertextlichen Strukturierung und zeigt immer auf einen Teil des Textes, zum Beispiel „im Folgenden“ (vgl. Diewald 11 - 151). Die Deixis ist eine Art die Wirklichkeit zu indizieren. Im Folgenden werden weitere Modelle erläutert.
3.2 Lotmans-Modell
Die These Lotmans lautet, dass die gesellschaftlichen (Oberschicht vs. Unterschicht), religiösen (Himmel vs. Hölle) und politischen Systeme (links vs. rechts) räumlich organisiert sind. Dieses Raummodell überträgt er auf narrative Texte. Um die räumliche Ordnung herum entsteht die Geschichte. Lotman unterscheidet dabei drei Ebenen von Oppositionen: die topologische Ebene (hoch vs. tief), die semantische Ebene (gut vs. böse) und die topographische Ebene (Stadt vs. Wald). Lotmans Modell betrifft alle narrativen Texte. Seine Figuren können statisch sein, das heißt sie überschreiten keine räumlichen Grenzen. Die Figuren können aber auch beweglich sein, das heißt, dass die Figuren aufgrund von besonderen Fähigkeiten die genannten Ebenen durchbrechen können. Immer wenn ein Protagonist eine Grenze übertritt, entsteht ein Ereignis. Ein Sujet bei Lotman ist ein komplexer Begriff, der die Handlung zusammenfasst. Ein Sujet beinhaltet die erzählte Welt mit ihren Ebenen, differenzierende Grenzen und einen Hel- den. Fragen, die für eine Textanalyse nach Lotman relevant werden, sind zum Beispiel: Welche Teilgebiete sind im Text enthalten? Welche Charakteristika haben sie? Welche Protagonisten befinden sich an welchem Ort? Wie sind die Grenzen gekennzeichnet? Wer überschreitet sie? Was ist passiert beim Überschreiten der Grenzen?
In sujethaften Schriften werden Grenzen durchbrochen, in sujetlosen nicht. Die räumliche Ordnung ist ein strukturelles Mittel in Opposition zu Nicht-Räumen. Der symbolische Raum, der sich über „bewusstseinsphilosophischer [...] medienanthropologischer Metareflexion“ definiert, wird durch Zeichen wiedergegeben (Lüdeke 2006: 432). Der Raum wird bestimmt durch kulturelle Aspekte der Zeichenanwendung an einem bestimmten Ort. Zeichen stehen demnach in Verbindung miteinander und ergeben so einen semantischen Wert, der eine gewisse Satzstruktur und Grammatik aufweist und durch ein Regelsystem kategorisiert und angeordnet wird. Das Zeichensystem bildet den kulturellen Raum im Text.
Die allgemeinsten sozialen, religiösen, politischen und moralischen Modelle der Welt, mit Hilfe derer der Mensch in den verschiedenen Etappen seiner Geistesgeschichte das ihn umgebende Leben begreift, sind stets mit räumlichen Charakteristika versehen, etwa in der Art der Gegenüberstellung ,Himmel - Erde‘ oder ,Erde - unterirdisches Reich‘ [...], oder in der Form einer sozial-politischen Hierarchie mit markierter Opposition von ,Oberen‘ und ,Unteren‘, oder in der Art der moralischen Merkmalhaltigkeit der Opposition ,rechts - links‘ [...](Lüdeke 2006: 530).
Lotman definierte die Sujettheorie. Dabei verknüpft er den Raum mit der erzählten Handlung (vgl. Martinez/Scheffel 2007: 156). In der Semiotik, der Zeichentheorie, ist der literarische Raum ein Konstrukt und keine vorgegebene Wirklichkeit. Der Text ist ein Bedeutungsträger stellvertretend für die Kategorie des Raums. Daraus resultiert, dass die erzählerische Vermittlung relevant wird. Der Ort steht oft in Verbindung mit der Figurendarstellung; dies nennt man Funktionalisierung (Lotman 1970: 532).
Was Lotman von anderen strukturalistischen Semiotikern unterscheidet, ist, dass er semantischen Konstitutionsaspekte der Stadtdarstellung mit Hilfe der Pragmatik analysiert und mit dem kulturellen Kontext verbindet. Seine Methode entspricht und funktioniert mit Hilfe der Kultursemiotik. Laut Lotman reagieren semantisierte Räume in Stadttexten auf die kulturhistorische Wirklichkeit „in den Worten Cassirers, also als historisch bestimmte ,Sinnform‘“ (Lüdeke 2006:458).
3.3 Mahler
Andreas Mahler nennt die Referentialisierungstechnik als wichtiges Instrument zur Einordnung von Texten. Bei Stadttexten ist die Referenz der Stadtname. Wenn die Referenz nicht im Titel vorkommt, gibt es meist schon früh im Text Lexeme, die auf die Stadt als außertextuellen Gegenstand verweisen. Mit dem Nennen der Stadt im Titel oder in den ersten Zeilen beziehungsweise mit dem Nennen eines referentiellen Gegenstandes, welcher in unserem Gedächtnis mit dem Ort verknüpft ist, zeigt uns der Autor schon anfangs, welche Stellung der Ort im Schriftstück einnehmen wird. „Wer möglichst rasch ein Text-London herstellen will, wird dementsprechend nicht mit einer weit ausladenden Deskription von Abbey Park beginnen, sondern mit Westminster Abbey, dem Tower und Big Ben“ (Mahler 1999: 15). Als „verdeckte Referentialisierung“ bezeichnet man die Nennung charakteristischer Eigenschaften zur Identifizierung eines Ortes: „eine Stadt voller Müll“, „die Stadt der Liebe“, „die Stadt, die niemals schläft“, „das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Als weiteren Typ neben der explizit referentiellen und der implizit referentiellen Methodik führt Mahler noch die semantische Stadtkonstitution an.
Die Semantisierung erfolgt zunächst durch den Aufbau eines Diskursivuniversums und die Bildung von Isotopien. Isotopien sind immer wiederkehrende Wörter desselben semantischen Feldes. Diese werden oft in Form von Beschreibungen geäußert.
Konstitutionsisotopien beschränken sich auf Kernlexeme wie „Stadt“, „Stadttor“, „Stadteinfahrt“. Mahler schränkt den Übergriff Isotopien ein, indem er sie auf die semantischen Felder der Stadt und des Stadtbaues einschränkt, so entsteht der Begriff Konstitutionsisotopien. Nach dem Beschreiben der Konstitutionsisotopien teilt man ein, ob es sich um eine Beschreibung eines eingeschränkten Ortes, eine Fensterperspektive oder um eine Vogelperspektive handelt. „Je stärker konturiert die Konstitutionsisotopie ist, je präziser die Referenzen, desto geringer enthebbar ist die Stadt. Je weniger proto- typisch die Nennung, je enger der Fokus, desto subjektiver, odiosynkratischer wird sie sein“ (Mahler 1999: 24). Die Konstitutionsisotopien können entweder harmonieren, homolog oder ambivalent sein. Wenn die Konstitutionsisotopien die Stadt eindeutig charakterisieren, handelt es sich um einen geschlossenen Typ, sonst um einen offenen Typ. Die diskursive Skizzierung der Stadt in einem Text ist notwendig, damit eine Raumskizze entsteht, in der man Personen und Handlungen sowie semantische Inhalte positionieren kann. Jede Textstadt wird nur in den Gedanken konstruiert.
Spezifikationsisotopien, auch Attribuierung genannt, beschränken sich auf die Attribute, welche einen Ort oder die Zeit beschreiben. (Mahler°1999:16)
Mahler behauptet, dass sich jede Stadt ihre individuelle Art anmaßt, wie über sie geschrieben und gesprochen wird. Der Ort, textextern wie -intern, verkörpert eine Rolle, die zum Betrachter mithilfe von Zeichen spricht. Die Aufgabe der Städter und Touristen ist es, diese Zeichen zu deuten und ihr Verhalten daran anzupassen. Jeder Besucher, der die Stadt noch nicht kennt, versucht zunächst Zeichenkombinationen zu finden. Diese können anhand von Wegweisern oder Tafeln auf Verkehrsrouten gelesen werden, zum Beispiel ,Pizzeria‘, ,Theater‘, ,Hafen‘. Darüber hinaus weist der Besucher der Stadt den Zeichen einen semantischen Zweck zu, zum Beispiel ,wichtig‘, ,unwichtig‘, und passt seine Handlungen an die Umgebung an, zum Beispiel: ,Hier gehe ich hin, wenn ich Hunger bekomme/ Bewohner einer Stadt nehmen über die Umgebung sprachliche Eindrücke wahr und entwickeln dadurch die „Stadtsprache“. „Wer die Stadt lesen kann, kennt sich in ihr aus; wer nicht, ist darin verloren“ (Mahler 1999: 11). In der Rolle des Lesers eines Textes ergeben sich viele Verbindungen zum Stadtmenschen: Beide deuten Zeichen (Syntax), sie verstehen Zeichen und orientieren sich danach (Semantik und Pragmatik). Mahler meint hierzu:
Im Folgenden geht es mir nicht um den Text der Stadt, nicht um dessen Zerlegung in diskrete Einheiten, deren Klassifizierung und Interpretation - die ist andernorts schon geleistet worden -, sondern um Texte über die Stadt; es geht mir also nicht um die Lektüre wirklicher Städte, sondern um textuelle Stadtlektüren.
Dabei verstehe ich unter ,Stadttexten‘ all jene Texte, in denen die Stadt ein - über referentielle beziehungsweise semantische Rekurrenzen abgestütztes - dominantes Thema ist, also nicht nur Hintergrund, Schauplatz, setting für ein anderes dominat verhandeltes Thema, sondern unkürzbarer Bestandteil des Texts (ebd. 12).
Andreas Mahler weist dem Stadttext die Eigenschaft zu, dass er ohne die Stadt und ihre Eigenschaften nicht lesbar beziehungsweise nicht sinnhaft lesbar wäre. Er erschließt die Trennung zweier Modelle: Er unterscheidet „Stadttexte“ und „Textstädte“. Die Mimesis der Stadt oder imaginierte Stadt nennt Mahler „Textstadt“. „Textstädte“ sind autonome Orte, bei denen die Kunst, eine Textstadt zu schaffen, im Vordergrund steht. Stadttexte lassen Textstädte erst entstehen. Stadtliteratur ist nichts anderes als ein Diskurs über eine Stadt. Eine Diegesis des Stadttexts findet statt, wenn der Autor „rein“ über eine reale Stadt schreibt.
Orientiert man sich nach dem semiotischen Modell von Saussure, erkennt man die Verbindung des Ausdrucks (Signifikant) mit dem Inhaltsträger (Signifikat). Demnach wären „Stadttexte“ die Signifikanten-Ketten beziehungsweise materielle Zeichenträger, während „Textstädte“ die dazugehörige Signifikat-Seite darstellen würden, den Inhalt (Bartetzky 2009: 160). Stadttexte haben das Ziel, Textstädte zu erzeugen. Stadtkonstitution oder diskursive Stadtgründungen haben immer Erkennungsmerkmale
Um den Anfang, an dem der Leser ein Wissensvakuum aufweist, zu verkürzen, ist der Romaneingang oft sehr informationsreich. Im Laufe des Lesens erkennt der Leser in der Regel, ob es sich um einen Stadttext handelt. Bei Stadttexten müssen demnach schnell die Referenz, die Konstitutionsisotopie und die Spezifikationsisotopie geklärt werden.
Die Arten der Stadtkonstitutionen schließen sich keinesfalls gegenseitig aus, im Gegenteil, sie treten meist gemeinsam auf, zum Beispiel durch den Gebrauch von prototypi- schen Plätzen oder Straßen in Verbindung mit beschreibenden Lexemen aus dem gleichen semantischen Feld (ebd: 19). Städte, die über Mahlers „Verfahren der Konstitution, Spezifikation und Referentialisierung“ produziert werden, differenzieren sich des Weiteren über verschiedene Perspektiven, aus denen sie erzählt werden können. Dies nennt Mahler „Modalisierung“. Hier unterscheidet er die interne, an die Person gebundene, und die externe, ungebundene Instanz. Da die Stimme des Erzählers den Ort beschreibt, ist sie perspektivgebend für die räumliche Wahrnehmung; so entstehen laut Mahler auktorial-erzählte Räume und figural-fokussierte Räume. Je nachdem welche der beiden Perspektiven der Raum annimmt, unterscheidet man textintern weiter, ob es entweder ein globaler, homologer oder geschlossener Textstadttyp ist. Der globale Textstadttyp steht dem partialen Textstadttyp gegenüber, gleich wie der homologe dem widerständigen Textstadttyp (Spezifikationsisotopien im Einklang vs. Widerspruch) und der geschlossene dem offenen Textstadttyp (Eindeutigkeit vs. Möglichkeit). Entscheidend bei der Modalisierung von Mahler ist die Distanz zwischen Wahrnehmungsgegenstand und dem Standpunkt der Wahrnehmung (vgl. Mahler 1999: 21). Die Stadt wird zunächst immer von einer Außenperspektive wahrgenommen. Danach unterscheidet man unter verschiedenen Wahrnehmungsarten; zum Beispiel einer Totalsicht oder einer Teilsicht der Stadt. Im Mittelpunkt steht die Position der wahrnehmenden Instanz in Verbindung mit ihrer Mobilität sowie der Art der Verarbeitung und Einteilung des Wahrgenommenen. Der Blick kann laut Mahler zwischen einer an Subjekte gebundenen Stadtwahrnehmung und einem überblicksmäßigen Blick auf die Stadt variieren. Der Erzähler überschaut ein Stadtpanorama. Er führt viele Teilelemente der Stadt zusammen (vgl.Mahler 1999: 22). Das Gegenstück zu der Panoramasicht stellt eine Art Fensterblick dar. Der Erzähler nimmt hier nur einen eingeschränkten Raum in einer Stadt wahr, so, als würde er durch ein Fenster blicken. Die Abhängigkeit zwischen wahrnehmendem Subjekt und Standort kommt hier sehr gut heraus. Mahler erfragt in weiterer Folge die Funktion diskursiver Stadtgründungen. Er will herausfinden, welche Rolle die Stadt textintern erfüllt. Weiters unterscheidet er extratextuell, ob es sich um „Stadt der Imagination“ oder „Städte des Realen“ handelt. In der Literatur des Mittelalters entstehen laut Mahler oft der Stadt übergeordnete semantische Felder: „Städte des Allegorischen“. Mahler unterscheidet drei Textstadttypen: „Städte des Allegorischen“ mit einer starken Präsenz von Spezifikationsisotopien, „Städte des Realen“ mit Betonung der Referentia- lisierung und einem realistischen Effekt und „Städte des Imaginären“, an denen die Konstitutionsisotopien dominant sind.
Die meisten Texte befassen sich mit dem Kreieren der Städte des Realen. Das heißt, man bekommt den Eindruck, über bestehende Städte zu lesen. „Städte des Realen“ verfügen also über einen ganz unterschiedlichen inneren Bau. Sie reichen von verfügungsgewaltigen, allmächtigen Globalansichten bis hin zu völlig subjektiven partikulären Teil-Bildern. Gemeinsam ist ihnen jedoch durchweg die Kaschierung ihrer Textualität: „Städte des Realen“ erzielen ihren Illusionseffekt aus Negierung ihres Textcharakters.
In der Literaturwissenschaft geht es darum, semantische Oppositionen zu finden. Im Falle der Stadt wäre dies die Stadt-Land-Opposition. Ist dieses Gegensatzpaar nicht existent, stirbt der Stadttext, aus dem urbanen Raum wird ein Nicht-Ort (ebd. 10-30).
Ein fundiertes Wissen über die Geschichte Neapels ist Grundlage für ein Verständnis der Situation, in der sich die Stadt und ihre Einwohner befanden und dies ist der Schlüssel zur Darstellung Neapels in der Literatur. Deshalb werden im Folgenden ein historischer Abriss und eine allgemeine Einführung in die Geschichte Neapels gemacht. Im darauffolgenden Hauptteil wird mit den obigen Modellen gearbeitet. Bei der Analyse wird bevorzugt Mahlers Modell angewandt, weil die Theorie nicht nur auf Romane anwendbar ist, wie etwa die Sujet-Theorie, sondern auf alle Genres passt und er einen aktuellen und schlüssigen Ansatz findet.
4 Geschichtlicher Kontext
Schaut man in die Antike zurück, sieht man schon damals die kulturelle Vielfalt Neapels mit den Griechen, Römern und Langobarden. Ab der Neuzeit hielten viele Völker in Neapel Einzug unter anderem die Franzosen, die Spanier und die Österreicher. Über die Jahrhunderte kam es zu einer intensiven Verschmelzung verschiedenster Kulturen (vgl. Richter 2005: 7 - 67).
Unter der Herrschaft dreier verschiedener spanischer Dynastien, die steuerliche Ausbeutung zelebrierten und vor allem auf dem Land sehr hohe Steuern von den Bürgern verlangten, was die Stadtflucht zur Folge hatte, erreichte Neapel im 18. Jahrhundert mit 300.000 Einwohnern den Status der größten Stadt Europas (vgl. Arnold 1991: 67).
Der hauptsächliche Steuerdruck lastete auf dem Land. Denn hier waren nicht nur alle direkten und indirekten Steuern an die Fiskalverwaltung des Hofes zu zahlen, sondern auch alle Lasten einer wiedererstarkten Feudalherrschaft zu tragen. (...) Fast ein Drittel der Gesamtpopulation des Königreiches suchte sein Heil in der Hauptstadt. Zugleich brach auf dem Land ein konstanter Bürgerkrieg aus. Ein Krieg, der bis weit ins 19. Jahrhundert dauerte. Es war der Krieg der zu Banditen degenerierenden Bauern gegen ihre Feudalherren und gegen die Vertreter und Agenten des “frühmodernen Staates”. Ein Krieg der im Namen des “guten alten Rechtes” geführt wurde und stets die Wiederherstellung der alten “guten” Ordnung im Auge hatte. (Arnold 1991:67;68).
Die Umstände im 18. Jahrhundert in der bourbonischen Hauptstadt waren geprägt von Armut, Hungersnöten und hygienebedingten Epidemien. Das Stadtbild war gezeichnet von Bettlern und Gelegenheitsarbeitern. Diese übernahmen nach und nach die Aufgaben, die später die Mafia ausführen sollte. Die Bettler, welche auch lazzaroni genannt wurden, waren einheitlich gekleidet, bewaffnet und unter ihnen herrschte ein hierarchisches System. Sie gaben sich nach außen unbewaffnet, hilfsbereit und zahm, um keine Aufmerksamkeit zu erregen und um nicht von den Königen bekämpft zu werden. Die Bourbonen wussten zwar über sie Bescheid, ließen sie aber größtenteils ihre illegalen Geschäfte gewähren und im Gegenzug waren die lazzaroni darum bemüht, dass die Bourbonen an der Macht blieben (Izzo 2009: 72). Mit der Französischen Revolution 1789 - 1799 veränderte sich auch die Situation in Neapel grundlegend. Alles begann 1789, als sich in Frankreich die ersten revolutionären Aufstände breitmachten. Der absolutistische Herrscher Ludwig XVI. war alleiniger Machtführer und Verwalter des Staates. In finanziellen Bereichen hatte er jedoch nicht die absolute Macht und musste den obersten Gerichtshof miteinbeziehen. Das Ständesystem des Absolutismus unterteilte Adelige, Klerus und das einfache Volk. Dieses Ständesystem manifestierte sich in ganz Europa, so auch in Neapel. Durch die Feldzüge Napoleons wurde 1799 Neapel zur parthenopäischen Republik ausgerufen, um wenige Jahre später, 1816, wieder von den Bourbonen zurückerobert zu werden. Diese wiederum zelebrierten das Ständesystem par excellence. Dies bedeutete für die lazaroni, deren Entwicklung unter der Führung Bonapartes litt, wieder eine Rückkehr zur Normalität. 1806 kam es zur Rückeroberung durch Napoleon Bonaparte. Währenddessen floh der bourbonische König ins Teilkönigreich Sizilien, wo er unter dem Schutz britischer Truppen stand. Wenig später erfolgte eine erneute Machtübernahme Neapels durch die Bourbonen. Der Wiener Kongress im Jahr 1815 führte dazu, dass auch Neapel wieder ins alte Regiment von König Ferdinand zurückfiel. Die Verdrändung der Franzosen und der Wiedereinzug der Bourbonen markierte politische Stagnation. Neapel war die Hauptstadt des Königreichs, als Zentrum des Königreichs Due Sicilie. In dieser Form blieb die Stadt bis zur Vereinigung Italiens Ende des 19. Jahrhunderts bestehen. Als im Mai 1860 beschlossen war, dass Neapel Teil des Königreich Italiens wurde, hieß das für die Stadt nicht nur Stagnation, sondern Rückschritt. Von der Hauptstadt eines Imperiums wurde Neapel zur Provinzhauptstadt degradiert (vgl. Richter 2005: 138 - 197). „Das große Neapel verliert seine Rolle als Hauptstadt, wird Teil jenes Mezzogiornos, das, von Turin, Mailand oder Rom aus gesehen, als ,unterentwickelter‘, ,rückständiger‘ Landteil erscheint.“ Mit dem Risorgimento, welches laut Candeloro den Weg zur Einigung Italiens durch die Eroberung Süditaliens von Giuseppe Garibaldi 1860 darstellt. Das Jahr 1861 markierte den Abzug des letzten bourbonischen Herrschers. Durch den Zusammenschluss der beiden Königreiche Sizilien und Neapel zum Königreich Beider Sizilien, erhoffte sich Ferdinand I. eine Abschaffung der sizilianischen Verfassung. Neapel war von 1816 - 1860 die Hauptstadt des Königreiches Beider Sizilien, welches sich über das gesamte Gebiet des heutigen Unteritaliens erstreckte. Bis 1861 blieb das Königreich als konstitutionelle Monarchie bestehen (Candeloro 1956: 14).
Nach der jahrelangen Fremdherrschaft fällt es den Neapolitanern schwer, ein Nationalgefühl für den neuen Staat zu entwickeln. Ihr Identitätsgefühl ist stark regional geprägt, wobei auch die Bourbonen grundlegende Spuren in der Identität der Bewohner hinterlassen haben (Arnold: 1991:108). Dazu kommt, dass sich Neapel zu jener Zeit durch seine geographische Lage klar vom Rest Europas abgetrennt hat, vom Norden durch das Apenningebirge und von den Nachbarstaaten durch das Mittelmeer. Der Fortschritt der Technik ermöglichte später eine bessere Kommunikation und einen Austausch mit der Außenwelt. Im 19. Jahrhundert waren Städte und Dörfer die Zentren des sozialen und politischen Lebens. Ein globales Denken, wie wir es heute kennen, existierte schier nicht. Das Königreich Italien war um 1900 ein von großen Gegensätzen gezeichnetes Land. Durch die Eroberung Roms verschwanden 1870 die Reste des Kirchenstaates und ab diesem Zeitpunkt wehten überall auf der Apenninen-Halbinsel die italienischen Fahnen. Das Königreich war unterteilt in drei politische Gruppen: die Nationalliberalen, die an der Monarchie festhalten wollten, die Nationaldemokraten, die modernere Ansichten hatten, und die revolutionären Demokraten mit Giuseppe Mazzini. Neben politischen Krisen herrschten in Neapel auch andere Missstände. So gab es neben großer Armut am Land und dem Nord-Süd-Gefälle ein großes Bildungsdefizit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Neapel teilte zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht den Status anderer Metropolen wie Mailand und Rom, wobei selbst diese im Vergleich zu europäischen Elitestädten wie London, Paris und Berlin rückständig waren. Der Süden Italiens war teilweise abgeschieden vom restlichen Europa. Trotz allgemeiner Krise im gesamten Königreich Italien folgte 1911 die Eroberung Libyens unter Viktor Emanuel III., der 1900 - 1946 König von Italien war.
Ganz Italien steckte in einer starken Identitätskrise. Keine einheitliche Sprache, keine politische Einheit und rückständige Verhältnisse zeichneten das Bild um 1900, dazu kamen in Neapel ein großes hygienisches Problem, Seuchen, Analphabetismus und das Bildungsdefizit. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts suchte Neapel eine schreckliche Choleraepidemie heim (vgl. Wollner 2010: 15 - 25).
Während der Norden langsam den Anschluss an die Industriezentren Europas schaffte, herrschten im Süden noch Feudalherrschaft und Agrarwirtschaft. Der Norden versuchte unterdessen mit Millionen an Finanzmitteln die katastrophalen hygienischen und infrastrukturellen Probleme Neapels und des restlichen Südens zu lösen. Alle Sanierungsmaßnahmen des Staates scheiterten jedoch an der korrupten Führung Neapels. Durch das Zensuswahlrecht durfte nur wählen, wer gewisse Finanzmittel nachweisen konnte. So waren kurz nach 1900 nur 2,2 % des italienischen Volkes wahlberechtigt; die Kluft zwischen der dünnen Schicht der gehobenen Bevölkerung und des restlichen Volkes war beklemmend (vgl. Wollner 2010: 25 - 35).
Die Folgen waren große Auswanderungswellen vor allem nach Amerika. Vom Hafen Neapel stachen unzählige Schiffe in See. Trotzdem passierte ab 1900 selbst in einer der Struktur schwächsten Regionen im Süden Italiens ein beträchtlicher Aufschwung. Vor allem im Bildungswesen ergaben Studien, dass zwischen 1901 und 1911 die Zahl der Analphabeten von 70,9 % auf 58 % schrumpfte (vgl. Wollner 2010: 35 - 45).
Durch die schwierigen Lebensumstände in der Stadt Neapel fanden extreme politische Strömungen wie der Faschismus mehr Anhänger als in den nördlichen Teilen des Landes. 1922 erfolgte schließlich der Marsch auf Rom. Der Faschismus wurde immer populärer und gipfelte schließlich in der Machtübernahme Mussolinis.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt Neapel mehrmals Ziel von Bombenanschlägen mit zahlreichen Toten. 1943 erfolgte der Fall Mussolinis, woraufhin Neapel kurz unter deutscher Besetzung war. Die Partisanen erkämpften sich die Stadt zurück, bevor die Amerikaner im Oktober 1943 die Stadt einnahmen. Unter den Amerikanern erlebte die Stadt eine Phase des Reichtums. In einer späteren Volksbefragung über den Verbleib der Monarchie oder den Ausruf der Republik stimmte Neapel, entgegen der Meinung des restlichen Landes, für den Verbleib der Monarchie.
In den Fünfzigerjahren bekam Neapel erneut Subventionen seitens der Regierung. Milliarden flossen in die Region, doch es folgten viele Fehlinvestitionen, Bauspekulationen und korrupte Geschäfte. Eine wichtige Person für die scheinbar ausweglose Situation der Fünfzigerjahre stellte Bürgermeister Achille Lauro dar. Lauro war ein korrupter Geschäftsmann und Besitzer eines Imperiums, das er nicht immer über legale Wege erwirtschaftet hatte. Obwohl er seinen Posten hauptsächlich zur Erweiterung seiner wirtschaftlichen Macht nutzte, genoss er große Beliebtheit des Volkes. Ihm folgte eine Reihe von Politikern mit ähnlichen Intentionen.
Erst mit der Wahl des Mitte-linken Antonio Bassolini im Jahre 1993 erfolgten Maßnahmen gegen die Korruption. Auch das Stadtbild veränderte sich; so versuchte man durch die Restauration und Sanierung von Gebäuden die Stadt aufzuwerten. Bassolini wurde 1997 mit 73-prozentiger Mehrheit wiedergewählt und 2000 Präsident Kampaniens. 2001 legte er seine Ämter nieder und seine Parteikollegin Rosa Russo Iervolino trat sein politisches Erbe an.
Im folgenden Hauptteil wird die zuvor dargebotene Methodik auf vier Werke der Neapelliteratur angewandt. Neapelliteratur ist ein von mir verwendeter Terminus, der alle literarischen Schriftstücke, die über die Stadt Neapel geschrieben wurden, zusammenfasst. In den folgenden Kapitel werden nun Beobachtungen in verschiedenen Werken vorgenommen.
5 II ventre di Napoli von Matilde Serao (1884)
5.1 Zwischen Flucht und Heimatliebe
Matilde Serao wurde 1856 in Neapel geboren. Während ihrer Kindheit musste sie aus Neapel fliehen, weil ihr Vater, ein Journalist und Anwalt, als Gegner der Bourbonen, politisch verfolgt wurde. In der Heimat ihrer griechischen Mutter fand die Familie Schutz. Nach dem Fall Francesco II. kehrten sie wieder nach Neapel zurück. Aufgrund ihrer turbulenten Kindheit konnte die spätere Lehrerin, Schriftstellerin und Journalistin im Alter von acht Jahren weder lesen noch schreiben. Neben der kranken Mutter bildete sich in ihr früh der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit. Ein sicheres Einkommen sollte ihr die Arbeit als Lehrerin bescheren. Nach ihrer Ausbildung entschied sie sich jedoch gegen die Lehrtätigkeit und begann zunächst für verschiedene Journale und Zeitungen zu arbeiten. Mit 26 Jahren verließ Serao Neapel und ging nach Rom (1882). Eine Zeit lang leitete sie dort ein Magazin. Nach einigen Jahren kehrte sie wieder nach Neapel zurück, neben journalistischer Tätigkeit schrieb sie hier auch literarische Werke. Sie war die erste Frau in Italiens Geschichte, welche eine Tageszeitung gründete. Ihre Werke stehen immer in enger Verbindung zur Heimat und sind stets kritisch und selbstreflektiert. Bis zu ihrem Tod 1927 (Banti 1965: 20 - 65).
5.2 Die Jahre der Säuberung
Neapel im Jahr 1884: Der Kollaps der Stadt wurde seit Jahrhunderten befürchtet, war aber bisweilen nie definitiv eingetreten. Stattdessen bestand Neapel in seiner konstant labilen Verfassung offenbar kaum verändert fort. Ein kleiner Teil der Bevölkerung lebte in Reichtum, der Rest kämpfte ums Überleben. Erneut brach aufgrund mangelnder Hygiene die Cholera aus, welche die ohnehin prekäre Lage der Stadt verschärfte. Durch das Etablieren einer Mittelschicht, Wirtschaftswachstum, Industrialisierung, Rechtsgleichheit und Bildung etablierte sich der Norden Italiens als Kapitalbringer des vereinten Italiens. Der Süden stand in Opposition zum Rest des Landes, er war bettelarm und unterentwickelt. Aus dieser Situation heraus entwickelte sich die questione meridionale. In diesem Ambiente entstand Matilde Serao Werk Il ventre di Napoli (Serao 1906: 10 - 25).
5.3 Analyse
Der Satz „Bisogna sventrare Napoli“ (Man muss Neapel ausweiden) leitet das Werk ein. Mit diesen Worten reagierte der Minister Agostino Depretis 1884 auf die Armut und das Leid nach dem Ausbruch der Cholera. Matilde Serao war zweiundzwanzig Jahre alt, als sie 1878 ihren ersten Essay über Neapel publizierte. Sie war damit eine der ersten weiblichen italienischen Journalistinnen nach der Vereinigung Italiens. Mit achtundzwanzig Jahren war ihr Werk dann bereit zur gesammelten Veröffentlichung. Mit Il ventre di Napoli schaffte Matilde Serao 1884 einen bipolaren Spagat zwischen Journalismus und Literatur (vgl. Snyder 2012: 1). Daria Valentini bezeichnete Matilde Seraos Schrift als eine autobiographische Dokumentation: „By incorporating documentary and autobiographical elements, the writer offers a unique perspective on the city of Naples and its identity in the late nineteenth century” (Valentini 2009: 133). 1906 erschien eine zweite, ergänzte Auflage mit folgender Einleitung:
Questo libro è stato scritto in tre epoche diverse. La prima parte, nel 1884, quan- do in un paese lontano, mi giungeva da Napoli tutto il sensodi orrore, di terrore, di pieta, per il flagello che l'attraversava, seminando il morbo e la morte: e il dolore, l'ansia, l'affanno che dominano, in chi scrive, ogni cura, d'arte, dicano quanto dovette soffrire profondamente, allora, il mio cuore di napoletana.
La seconda parte, è scritta venti anni dopo, cioè solo due anni fa, e si riannoda alla prima, con un sentimento piu tranquillo, ma, ahimè, piu sfiduciato, piu scet- tico che un miglior avvenire sociale e civile, possa esser mai assicurato al popolo napoletano, di cui chi scrive si onora e si gloria di esser fraterna emanazione. [..] Matilde Serao
Serao schafft eine abbildhafte Realiendarstellung. Gleich zu Beginn des Textes, in der zweiten Zeile der Textstelle, steht die Referenz „Napoli”. Die Attribuierung erfolgt im ersten Absatz über den Aufbau eines semantischen „locus terribilis” durch Lexeme wie „orrore”, „terrore”, „morte”, „dolore”, „l’ansia”. Die Stadt wird auch in allegorischer Form als schmutzige, wollüstige, verschlingende Figur dargestellt. Neapel wird als verfallene Schönheit zum Paradigma der Beziehung zwischen Hässlichkeit und Begehrenswürdigkeit (vgl. Schaff 1999: 180) Gleich anfangs erklärt sie auch, dass sie nicht Teil der erzählten Welt ist, als sie mit „quando in un paese lontano” klarstellt, dass sie sich weit vom Geschehen entfernt aufhält. Einsicht in ihre Gefühlswelt erfahren wir anhand der Phrase „soffrire profondamente, allora, il mio cuore di Napoli”.
Beim Verweis auf den zweiten Teil wird zunächst die Kontextualisierung mit dem zeitlichen Marker „venti anni dopo“ angeführt. Danach ist aufgrund der Präsenz der Komparativ Forme „piu tranquillo” eine Verstärkung beziehungsweise Verbesserung der Stimmung spürbar. Dies wird jedoch durch das konzessive Satzgefüge mit dem Bindewort „ma” sofort wieder unterbunden. Nur in der zweiten Auflage, die in der vorliegenden Arbeit analysiert wird, teilt Serao das Werk in drei Überkapitel: Il ventre di Napoli (venti anni fa), Il Ventre di Napoli (adesso) und L ‘Anima di Napoli. Mit einigen Aussparungen findet man in der Schrift ein Neapelbild im Querschnitt von mehr als zwanzig Jahren, dabei stellt die Autorinstanz die Stadtstruktur und Organisation in den Fokus. Die Schilderungen erscheinen in vielen autonomen Unterkapiteln verkürzt und symbolhaft. Die Komposition schematischer Stadtarchitektur ist angelehnt an die städtische Entwicklung der Zeit und zeigt eine Skizzierung der Innenstadt.
In il ventre di Napoli passiert die erste Referentialisierung schon im Titel mit der Klärung des Erzählortes. In weiterer Folge kommt es zur Personifizierung der Stadt, die man vor allem im letzten Teil, wenn die Stadt selbst spricht, wahrnehmen kann, aber die Stadt tritt auch in metaphorischer Form im Laufe des Buches figural auf, zum Beispiel als „der Bauch von Neapel“. Der Bauch steht für einen Teil der verkörperten Stadt. Wie der Bauch ist auch der Raum in der Stadt ein eingeschränkter Ort, der sich topographisch von anderen abhebt. Diese Vermenschlichung der Stadt beschreibt Serao unter anderem auch mit dem Begriff sventrura. Dabei bezieht sie sich auf die Reform, die Minister Depretis in einer Ansprache sventrura., zu Deutsch „die Ausweidung der Gedärme“, nannte. Sie sollte Neapel aus der Krise helfen. Durch den Bau breiter Straßen, die dunkle Gassen zerschlugen, sollte ein schöneres Stadtbild entstehen. Grund für die Neuerungen waren die schlechten gesundheitlichen beziehungsweise hygienischen Bedingungen. (Serao 1884: 10 - 15).
[...]
- Arbeit zitieren
- Madeleine Magnet (Autor:in), 2018, Die Darstellung der Stadt Neapel. Eine literarische Reise vom endenden 19. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/975766
Kostenlos Autor werden

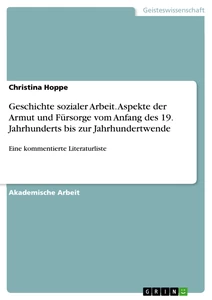
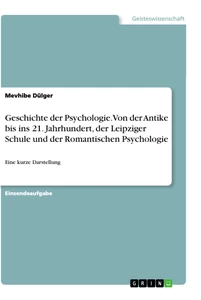
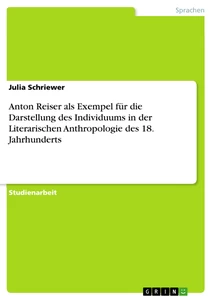
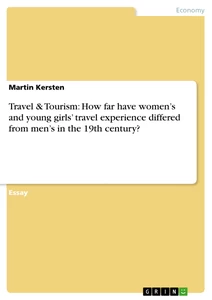


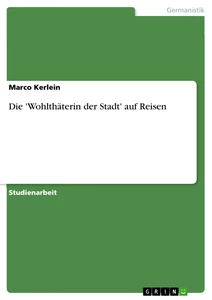
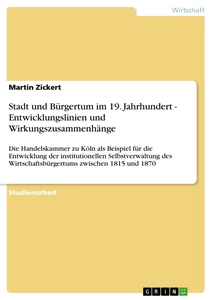
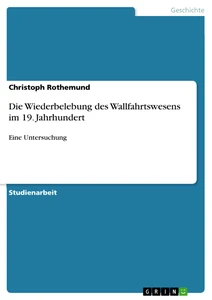




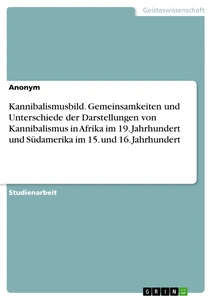
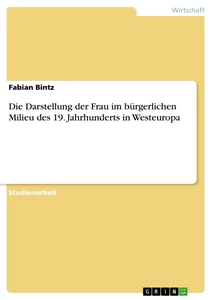
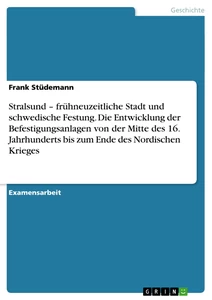
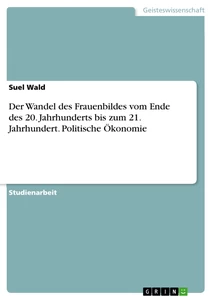
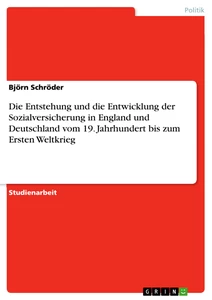
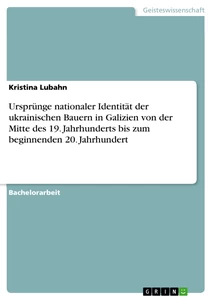
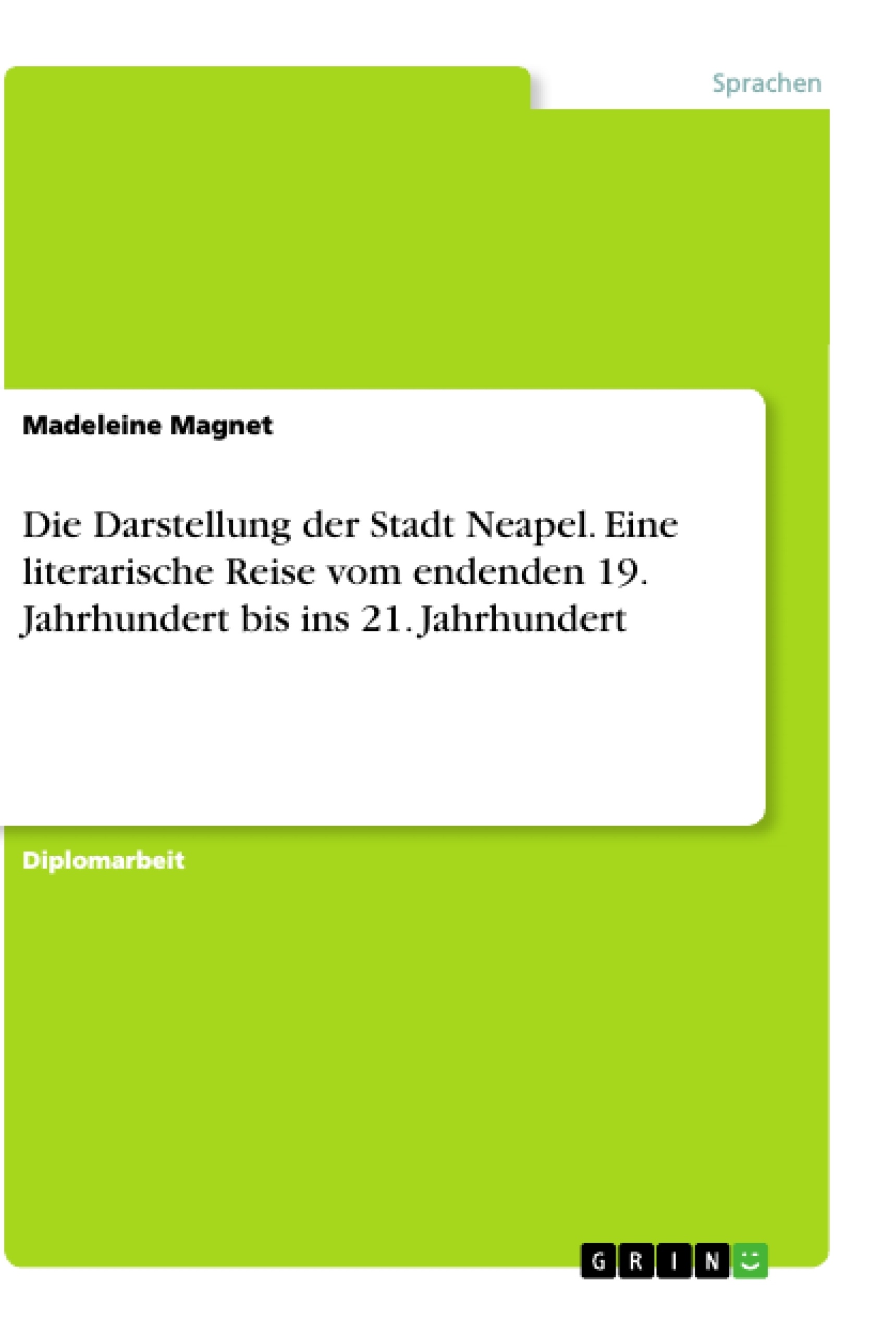

Kommentare