Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Terminologie
2. Die Sprachensituation in der Schweiz
2.1 Diglossie oder Bilingualismus?
2.2 Die schweizerische Standardsprache
2.3 Spracheinstellungen
2.4 Literatur zur Aussprache des Schweizerhochdeutschen
2.5 Literatur zum Einfluss auf die Aussprache
2.5.1 Geschlecht
2.5.2 Alter
2.5.3 Bildung und soziale Klasse
2.5.4 Spracheinstellungen
2.5.5 Persönlichkeit
2.5.6 Medienkonsum
2.5.7 Sprachgebrauch
2.6 Die Aussprachenormen der schweizerischen und deutschländischen Standardsprache
2.6.1 Vokale
2.6.2 Konsonanten
2.7 Hypothesen
3. Experiment 1
3.1 Methoden
3.1.1. Erhebungen im Rahmen des SDATS-Projekts
3.1.2. Ortschaften
3.1.3. Gewährspersonen
3.1.4. Material
3.1.5. Vorgehensweise
3.2 Resultate
3.2.1 Generelle Verteilung
3.2.2 Verteilung einzelner Features
3.3 Vergleich der Ergebnisse und Erklärungsversuche
3.3.1 Total Score
3.3.2 Die r -Laute
3.3.3 Der alveolare Frikative / s /
3.3.4 Der Laut für den Buchstaben <ä>
3.3.5 Die Frikative /x/
3.3.6 Die Affrikate /k/
3.3.7 Die Lautverbindung [ks]
3.3.8 Weitere Einflüsse auf die Aussprache
4 Experiment 2: Perzeptionsanalyse
4.1 Methoden
4.1.1 Studiendesign
4.1.2 Gewährspersonen
4.1.3 Vorgehensweise
4.2 Allgemeine Resultate
4.2.1 Faktoren, welche die Ratings beeinflussen
4.2.1.1 Bildung
4.2.1.2 Alter
4.3 Diskussion der Perzeptionsanalyse
5. Gesamtdiskussion
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
7.1 Online Referenzen
7.2 Artikel
8. Anhang: Excel-Tabelle mit den kodierten Daten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Mögliche Stilregister des Schweizerhochdeutschen (Hove 2002, 13)
Abb. 2 Die 125 Ortschaften des SDATS-Projektes (Leemann et al. 2020)
Abb. 3 Beispiel für ein phonetisches Item (Leemann et al. 2020b)
Abb. 4 Beispiel für ein morphosyntaktisches Item (Leemann et al. 2020b)
Abb. 5 Beispiel für ein lexikalisches Item (Leemann et al. 2020b)
Abb. 6 Übersicht der ausgewählten Ortschaften in grün
Abb. 7 Ausschnitt aus dem Fragebogen: Medienkonsum
Abb. 8 Ausschnitt aus der Excel-Tabelle mit den kodierten Daten zum Medienkonsum
Abb. 9 Ausschnitt aus der Excel-Tabelle mit den kodierten Daten zur Spracheinstellung
Abb. 10 Ausschnitt aus der Excel-Tabelle mit den kodierten Daten zur Persönlichkeit
Abb. 11 Ausschnitt aus der Excel-Tabelle mit den kodierten Daten: Sprachgebrauch
Abb. 12 Stimmhaftigkeit des s-Lautes im Wort sich
Abb. 13 Übersicht der ausgerechneten Quotienten der einzelnen Lautgruppen und die Summe der Quotienten
Abb. 14 Generelle Verteilung
Abb. 15 Summe der r-Laute
Abb. 16 Summe der s-Laute
Abb. 17 Summe der Laute für <ä>
Abb. 18 Verteilung der Werte nach Wort
Abb. 19 Summe der Frikative /x/
Abb. 20 Summe der k-Laute
Abb. 21 Verteilung der Werte nach Wort: niedrigster und höchster Wert
Abb. 22 Summe der ks-Laute
Abb. 23 Der Einfluss aussersprachlicher Faktoren auf die Aussprache der analysierten Laute
Abb. 24 Der Einfluss aussersprachlicher Faktoren auf die Aussprache von /s/
Abb. 25 Der Einfluss aussersprachlicher Faktoren auf die Aussprache von <ä>
Abb. 26 Der Einfluss aussersprachlicher Faktoren auf die Aussprache von /x/
Abb. 27 Der Einfluss aussersprachlicher Faktoren auf die Aussprache von /k/
Abb. 28 Der Einfluss aussersprachlicher Faktoren auf die Aussprache von <chs>
Abb. 29 Screenshot aus dem SoSci-Survey Fragebogen: die Bewertung des Sprechers
Abb. 30 Bewertung der Varietäten nach Sympathie
Abb. 31 Bewertung der Varietäten nach Kompetenz
Abb. 32 Bewertung der Varietäten nach Attraktivität
Abb. 33 Einfluss des Bildungsstandes auf die Bewertung von BDnah bezüglich Kompetenz
Abb. 34 Die Bewertung von CHnah bezüglich Attraktivität nach dem Faktor Alter
Abb. 35 Die Bewertung von BDnah bezüglich Kompetenz nach dem Faktor Alter
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Übersicht für die Aussprache von akzentuierten Vokalen (vgl. Haas 2009, 264)
Tabelle 2 Übersicht für die wichtigsten Aussprachehinweise von Konsonanten (vgl. Haas 2009, 267)
Tabelle 3 Übersicht der Gewährspersonen mit den jeweiligen UIDs
Tabelle 4 Übersicht der analysierten Features
Tabelle 5 Übersicht der befragten Personen für die Perzeptionsstudie
Tabelle 6 Übersicht der erzielten Durchschnittswerte der Aussprachevarietäten nach Kompetenz, Sympathie und Attraktivität (höchste Punktzahl in rot)
1. Einleitung
Die spezielle Beziehung, die Deutschschweizer und Deutschschweizerinnen1 zur Aussprache ihrer offiziellen Muttersprache Deutsch hegen, stellt nicht nur in der Wissenschaft einen Sonderfall dar, sondern wird auch im Land selbst häufig diskutiert. Obwohl ein gewisses Bewusstsein über regionale Unterschiede der deutschen Standardsprache existiert, wird die eigene Standardaussprache in den meisten Fällen als minderwertig und fehlerhaft betrachtet (vgl. Guntern 2009, 5). Generell scheint es klare Vorstellungen zu geben, wie die schweizerische Aussprache von Standarddeutsch klingen – oder eben nicht klingen – darf. Diese Meinungen unterscheiden sich jedoch stark. Wird in einem schweizerischen Kontext versucht, die Standardsprache wie die nördlichen Nachbaren zu sprechen, wird dies allgemein nur toleriert, sofern man einen gewissen Prozentanteil deutschen Blutes nachweisen kann. Ansonsten wird man nicht nur belächelt, sondern auch als unsympathisch und angeberisch abgestempelt. So heisst es über Personen, die ein deutschländisches Deutsch sprechen – wie es beispielsweise die Sängerin Stefanie Heinzmann aus dem Wallis in Interviews in Deutschland tut – man „will mit einem aufgesetzten Bühnendeutsch brillieren“ und wird in die Schublade der „urbane[n] Schickeria“ gesteckt, da man dem „Trend“ (Tages-Anzeiger: 21.05.2010) verfallen ist. Andererseits wurde beispielsweise der Berner Schauspielerin Sabine Timoteo nach ihrem Gastauftritt im Münchner Tatort mehrfach in der Presse vorgeworfen, in einem „so haarsträubend übertriebenen Hochdeutsch mit Schweizer Akzent“ gesprochen zu haben, „dass sich hiesige «Tatort»-Fans gehörig auf die Füsse getreten fühlten“ (Tages-Anzeiger: 31.03.2009). Die Figur der Gabi Kunz empörte viele Schweizer:innen, da sie ihrer Meinung nach zu schweizerisch sprach und sogar die Frage gestellt wurde, ob „jemand mit IQ über 50 überhaupt so reden kann“ (Tages-Anzeiger: 31.03.2009). In seiner Wegleitung zur Aussprache des Hochdeutschen in der Schweiz beschrieb Boesch bereits 1957 diese ambivalente Haltung der Deutschschweizer:innen gegenüber der Standardaussprache: „Beim Schauspieler ist es uns peinlich, den Schweizer herauszuhören; in allen anderen Sprechsituationen ist es ebenso peinlich, ihn nicht zu vernehmen“ (Boesch 1957, 12ff., zit. n.: Hove 2002, 13). Die Standardaussprache in der Schweiz kann also je nachdem eine mehr schweizerische oder mehr deutschländische Färbung aufweisen, abhängig von der Art wie die einzelnen Laute realisiert werden (vgl. Guntern 2012, 105) und die Meinungen darüber, welche Varietät bevorzugt werden soll, teilen sich. Es existiert jedoch eine weitverbreitete Übereinkunft darüber, welche Färbung beim Sprechen der Standardsprache in gewissen Kontexten angebracht ist, was als schweizerhochdeutsche Sprachkonvention definiert ist (vgl. Hove 2002, 6). Die Charakteristika der schweizerischen Aussprache des Standarddeutschen werden bereits seit vielen Jahren in der Forschung diskutiert und analysiert. Das Ziel der folgenden Masterarbeit ist es jedoch herauszufinden, ob andere Faktoren als die Aussprachekonvention die Standardaussprache der Deutschschweizer:innen beeinflussen könnten. Dabei wird der Fokus spezifisch auf die Metadaten der Sprecher:innen gesetzt. Somit befasst sich diese Arbeit mit folgender Fragestellung:
Inwiefern wird die Aussprache des Standarddeutschen vom soziodemografischen Hintergrund der Sprecher:innen beeinflusst?
In einem ersten Teil dieser Masterarbeit wird auf die sprachliche Situation in der Schweiz eingegangen, dabei wird die Beschreibung der vorherrschenden Situation als Diglossie erklärt und die wissenschaftliche Diskussion um diesen Begriff aufgezeigt (Kapitel 2.1). Darauffolgend wird das Konzept der Standardsprache und Sprachkonvention nähergebracht (Kapitel 2.2), bevor auf die vorherrschenden Spracheinstellungen eingegangen wird (Kapitel 2.3). Im Anschluss daran wird der Stand der Forschung erläutert (Kapitel 2.4 und 2.5) und die Aussprachenormen von Standarddeutsch in Deutschland und vor allem in der Schweiz dargelegt (Kapitel 2.6). Um der oben genannten Fragestellung nachzugehen, wurden für diese Untersuchung Aufnahmen vorgelesener Standardsprache analysiert. Dieses Experiment wird im dritten Kapitel behandelt. Im Kapitel 3.1 wird die Methodik für diese Studie vorgestellt. In Unterkapiteln werden darauffolgend das SDATS-Projekt, in dessen Rahmen die Daten gesammelt wurden, die Ortschaften, die Gewährspersonen, das Material mit den untersuchten Features und Metadaten und die Vorgehensweise erklärt. Anschliessend werden die Resultate präsentiert und in Bezug auf vorhergehende Studien und Effekte der Metadaten diskutiert (Kapitel 3.2 und 3.3). In einem zweiten Teil der Arbeit soll zudem überprüft werden, ob sich die gängigen Stereotypen und Einstellungen gegenüber verschiedenen Ausprägungen der Standarddeutschen (Aus-)Sprache in den Bewertungen eines Sprechers widerspiegeln. Mittels einer Perzeptionsstudie wird aufgezeigt, wie Deutschschweizer:innen aktuell verschiedene Aussprachevarietäten der deutschen Standardsprache wahrnehmen und den jeweiligen Sprecher nach diversen Kriterien beurteilen (Kapitel 4). Auch für diese Studie wird zuerst die Methodik mit der Vorgehensweise und den Gewährspersonen (Kapitel 4.1) vorgestellt, bevor auf die Resultate eingegangen wird (Kapitel 4.2). In einer abschliessenden Diskussion werden die Resultate beider Experimente in Verbindung gebracht und vor dem Hintergrund der in Kapitel 2.7 genannten Hypothesen diskutiert (Kapitel 5). Mit einem Fazit im sechsten Kapitel wird die vorliegende Arbeit abgeschlossen.
1.1 Terminologie
Zu Beginn sollen einige Begriffe erläutert werden, die in dieser Arbeit häufig verwendet werden. Dazu gehört als erstes das Wort Variante. Das Metzler Lexikon zur Sprache definiert Variante wie folgt: „Realisierung einer linguistischen Einheit in einer konkreten Äusserung“ (Glück 2010, 745). Auf der Ebene der Lautung gelten zum Beispiel die verschiedenen Realisierungsformen des r -Lautes als Varianten: Man kann /r/ als [r], [ɾ], [ʀ] oder [ʁ] aussprechen. Das sind dementsprechend vier Varianten des Lautes /r/, von denen einige als eher schweizerisch oder deutschländisch gelten. Der Begriff Varietät kommt vom Lateinischen varietas und bedeutet Verschiedenheit. Er wird definiert als „Teil einer ganzen Spr. [Sprache], die in aller Regel eine grössere Zahl von V. [Varietäten] umfasst, z. B. Dialekte, eine Standardvarietät“ (Glück 2010, 746). Hove ist der Meinung, dass nur dann von einer Varietät gesprochen werden kann, wenn die verschiedenen Varietäten einerseits in sich ein gewisses Mass an Einheitlichkeit aufweisen und sich andererseits gegenüber anderen Varietäten abgrenzen. So kann man zum Beispiel das Alemannische und das Bairische als geographisch definierte Varietäten (in diesem Fall Dialekte) bezeichnen, die sich auch sprachlich unterscheiden. (Hove 2002, 3).
In Bezug auf die vorliegende Arbeit ist die schweizerische Standardsprache eine Varietät von Standarddeutsch.
Ein weiterer wichtiger Begriff ist Hochdeutsch, was wie folgt definiert wird: „Sammelbez. [Sammelbezeichnung] für den Teil des kontinental-westgermanischen Dialektkontinuums südlich der Uerdinger Linie des Rheinischen Fächers, der im Gegensatz zum Niederdeutschen die zweite (oder hochdeutsche) Lautverschiebung ganz oder teilweise vollzogen hat“ (Glück 2010, 270). Generell wird Hochdeutsch als Synonym von deutscher Standardsprache verstanden, wobei die schweizerische Varietät ebendieser Standardsprache als Schweizerhochdeutsch bekannt ist (vgl. Hove 2002, 4f.). In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der Schriftsprache zu erwähnen, der als Gegenbegriff zu Schweizerdeutsch (wiederum ein Sammelbegriff für die verschiedenen Dialekte in der Schweiz) zu verstehen und somit synonym zu Standardsprache ist (vgl. Kolde 1981, 72). Um im Folgenden klar zwischen Schweizerhochdeutsch und Hochdeutsch zu unterscheiden, wird jeweils von der schweizerischen und deutschländischen Standardaussprache gesprochen.
2. Die Sprachensituation in der Schweiz
2.1 Diglossie oder Bilingualismus?
Laut der Bundesverfassung ist die Schweiz ein viersprachiges Land. Neben Deutsch, Italienisch und Französisch zählt auch Rätoromanisch zu den vier Landessprachen. Dies gilt jedoch lediglich für den Bund und nicht für die einzelnen Kantone, die alle bis auf vier Ausnahmen institutionell einsprachig sind. Während somit die meisten Kantone in der Deutschschweiz offiziell einsprachig sind, projiziert sich auf individueller Ebene ein anderes Bild. Werden Schweizer:innen nach der sprachlichen Situation in der Deutschschweiz gefragt, wird stolz erklärt, dass obwohl Deutsch die offizielle Sprache ist, allgemein nur der Dialekt zur Kommunikation verwendet wird. „In dieser Spannung zwischen institutioneller und individueller Mehrsprachigkeit, zwischen Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip hat sich die Deutschschweizer Diglossie entwickelt und gefestigt“ (Werlen 2004, 1). Der Begriff der Diglossie wurde 1959 von Ferguson für die auffällige Beziehung zwischen Mundart und Standardsprache in der Schweiz vorgeschlagen (vgl. Haas 2004, 81). Er definiert ihn wie folgt:
Diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature [...] which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation. (Ferguson 1959, 336)
Das zentrale Merkmal der Diglossie ist die Unterscheidung von Kontexten, in denen entweder die High Variety, die überlegene Varietät, oder die Low Variety, die regionalen Dialekte, verwendet wird (vgl. Ferguson 1959, 327). Dazu erstellte Ferguson eine Liste: Während zum Beispiel in persönlichen Briefen, im Unterricht und in Nachrichtensendungen die High Variety verwendet wurde, herrschte in Kontexten wie Kommunikation mit Freunden, Familie und Arbeitskolleg:innen der Dialekt vor (vgl. Berthele 2004, 114).
Lange galt die Situation in der Deutschschweiz als „Musterfall einer Diglossiesituation“ (Hägi/Scharloth 2005, 35). Laut Haas ist die Beschreibung einer Diglossie bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch zutreffend gewesen und stellte für die Bevölkerung kein Problem dar: „Man schrieb die Standardsprache, und bei Gelegenheiten, die den ‚gehobenen’ mündlichen Ausdruck verlangten [...], sprach man sie auch“ (Haas 2000, 81). Jedoch breitete sich der Gebrauch vom Dialekt schnell auf Kontexte aus, in denen zuvor stets die Standardsprache verwendet wurde, wodurch sich die diglossischen Verwendungsregeln verschoben (vgl. Haas 2004, 84). Zwar werden die Nachrichten im Radio und Fernsehen auch heute noch auf Standarddeutsch gehalten, Regionaljournale und Regionalradios wechselten jedoch auf den Dialekt. Auch Predigten in reformierten und katholischen Kirchen finden vermehrt im Dialekt statt. Die mündliche Kommunikation erhielt dementsprechend durch soziologische und technische Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen immer grösseren Stellenwert. „Für immer mehr Situationen wurden informellere Register/Varietäten als angemessen betrachtet. In der Diglossie vermehrten sich somit die Kontexte für den Dialekt bis hin zu einer Varietätenverteilung, die nur noch vom Medium gesteuert schien [...]“ (Haas 2004, 84). Kolde beschrieb diese sprachliche Lage 1981 folgendermassen:
Die Mundart ist für alle Deutschschweizer mit zumindest minimaler Schulbildung [...] auch funktionale Variante [...], und zwar werden Mundart und Schriftdeutsch komplementär in Abhängigkeit vom Medium (gesprochen – geschrieben), Formalitätsgrad der Situation (formell – informell) und eigenem Rollenverständnis und Rollenerwartungen gebraucht. Da das Medium am häufigsten Ausschlag gibt, sprechen wir von medialer Diglossie. (Kolde 1981, 68)
Der schriftliche Sprachgebrauch in den jüngeren elektronischen Medien stellt diese Behauptung jedoch wieder in Frage. Nach Koldes Theorie müssten Kommunikationsformen wie E-Mail, SMS, Beiträge auf sozialen Medien etc. in der High Variety verfasst werden, was jedoch in der Realität für die meisten Deutschschweizer:innen nicht der Fall ist. Bereits 1998 erläuterte Werlen, wie geschriebener Dialekt abgesehen von Dialektliteratur ebenfalls in persönlicher Kommunikation, beispielsweise in Briefen, vorgefunden wird. Auch wenn sich die Verwendung von Dialekt in mündlichen Kontexten vermehrt hat, konnte Werlen „einen Rest der Diglossieverteilung im schriftlichen Bereich [finden]: Dialekt wird primär in persönlichen und emotionalen Beziehungen verwendet, im öffentlichen, massenmedialen Bereich dagegen wird fast ausschliesslich Hochdeutsch geschrieben“ (Werlen 1998, 30). Die Entwicklungen der Verwendung von Dialekt im öffentlichen Bereich, wie in den sozialen Medien, widerspricht Teilen Werlens Beobachtung. „Der schriftelektronische Dialektgebrauch hat zweifellos ganz andere Dimensionen angenommen, als die traditionelleren Formen schriftlicher Dialektverwendung, wie Werlen sie noch 1998 beschreibt“ (Haas 2004, 85). Die Beschreibung der deutschschweizerischen Sprachsituation als mediale Diglossie stösst aufgrund der Zunahme von geschriebenem Dialekt deswegen vermehrt auf Kritik. Trotzdem darf nicht behauptet werden, dass Standarddeutsch gar nicht mehr gebraucht wird. (vgl. Schümann 2008, 455). Werlen kommt zum Schluss, dass das Medium der Kommunikation ein ausschlaggebender Faktor zur Wahl von Dialekt und Standardsprache ist, es jedoch noch weitere gibt wie „Adressatenabhängigkeit, Oralität und Literalität des Stils, Funktionen der Nähe oder der Distanz, und weitere Funktionen wie Selbstdarstellung, Autoritätsstil, Zitierung usw.“ (Werlen 2004, 24).
In der Debatte über die sprachliche Situation in der Schweiz wird neben der Beschreibung einer Diglossie auch die des Bilingualismus diskutiert. Laut Ris erfüllt der Dialekt in der Deutschschweiz nahezu jede Funktion, die die Standardsprache in anderen Ländern auch erfüllt (vgl. Ris 1990, 42, zit. n.: Hägi/Scharloth 2005, 35). Durch diese komplementäre Verteilung der Funktionen beider Varietäten „ist die wichtigste Bedingung für das Vorliegen einer Diglossiesituation nicht mehr gegeben [...]. Für Ris war daher klar, dass Standarddeutsch als Zweitsprache im Sinne des Bilingualismus-Modells zu werten sei“ (Hägi/Scharloth 2005, 35). Durch die Behauptung, dass in der Deutschschweiz Bilingualismus vorherrsche, ergibt sich in der Sprachwissenschaft die Frage, ob Dialekt und Standardsprache nun zwei Varietäten derselben Sprache sind, und wenn nicht, ob Standarddeutsch somit eine Fremdsprache ist. Dass jedoch nur von Bilingualismus gesprochen werden darf, insofern es sich um zwei systematisch verschiedene Sprachen handelt, ist laut neueren Definitionen nicht mehr der Fall (vgl. Hägi/Scharloth 2005, 36). Nach Lüdi ist mehrsprachig, „wer sich irgendwann in seinem Leben im Alltag regelmässig zweier oder mehrerer Sprachvarietäten bedient [...] unabhängig von der Symmetrie der Sprachkompetenz, von den Erwerbsmodalitäten und von der Distanz zwischen den beteiligten Sprachen“ (Lüdi 1996, 234). In der Diskussion über die Diglossie-Bilingualismus-Debatte wird somit häufig auch die Ähnlichkeit der beiden Varianten als ausschlaggebend definiert. Allerdings wird dies auch scharf kritisiert. So merkt Haas an, dass es nicht reicht, „einen Punkt auf einer sprachlichen Ähnlichkeitsskala definieren zu wollen, ab dem eine Situation ‚gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit’ als Diglossie oder aber als Bilingualismus gelten soll“ und man sich in dieser Diskussion „nicht allein auf die linguistische ‚Verwandtschaft’ der Varietäten stützen darf“ (Haas 2004, 87f). Auch die gegenseitige Verständlichkeit der beiden Varietäten sowie die Spracheinstellung gegenüber den Schweizer Dialekten und der Standardsprache wird in diesem Zusammenhang oft diskutiert (vgl. Brommer 2014, Werlen 1998, Berthele 2004, Hägi/Scharloth 2005). Nach einer Umfrage von Berthele wird die deutsche Standardsprache nicht einfach als eine weitere Sprache angesehen, sondern erfüllt Fremdsprachenstatus. Er erklärt: „Die Fremdheit des Hochdeutschen nimmt für den Deutschschweizer im Bereich der Mündlichkeit mit abnehmenden Formalitätsgrad zu“ (Berthele 2004, 127f.). Die Ergebnisse einer Studie von Hägi und Scharloth zeigen jedoch das Gegenteil: Die Standardsprache ist im Bewusstsein der Mehrheit der Sprecher:innen keine Fremdsprache (vgl. Hägi/Scharloth 2005, 40).
Verschiedene Linguist:innen bieten somit unterschiedliche Lösungsvorschläge an. Berthele kommt zum Schluss, dass der Begriff Zweisprachigkeit die Sprachrealität der Deutschschweizer am besten beschreibt, wobei es sich jedoch um einen speziellen Fall der Zweisprachigkeit handelt (vgl. Berthele 2004, 131). Werlen wiederum argumentiert, dass es sich um eine asymmetrische Zweisprachigkeit handelt, welche die Produktivität (man spricht Dialekt und schreibt die Standardsprache), die Rezeptivität (man hört Dialekt und liest ihn selten, während man die Standardsprache hört und liest) und die Verständlichkeit (Deutschschweizer:innen verstehen die Standardsprache, Deutsche verstehen jedoch keinen Dialekt) betrifft (vgl. Werlen 1998). Hägi und Scharloth äussern einen weiteren Vorschlag für die Beschreibung der Sprachensituation: das Konzept der Sekundärsprache. Während die Primärsprache das von der Mehrheit der Sprecher erst gelernte Idiom darstellt, erfolgt der Erwerb produktiver Kompetenz der Sekundärsprache zumindest teilgesteuert, jedoch i. d. R. nicht vollständig gesteuert wie bei prototypischen Fremdsprachen. Im Vergleich zur Primärsprache wird die Sekundärsprache von den autochthonen Sprechern untereinander seltener verwendet, gehört im Gegensatz zu einer Fremdsprache durchaus zum Alltag. (Hägi/Scharloth 2005, 41).
Zusammenfassend ist es für die Sprachensituation in der Schweiz von Bedeutung, die Konzepte Diglossie und Bilingualismus nicht als zwei entgegengesetzte Pole auf einer zweidimensionalen Achse zu betrachten. Wird die Situation als Bilingualismus beschrieben, ergibt sich daraus nicht automatisch die Definition Standardsprache = Fremdsprache. Genauso darf bei einer Bestimmung der Situation als Diglossie nicht geschlussfolgert werden, dass die alemannischen Dialekte und die Standardsprache Varietäten der gleichen Sprache sind (vgl. Hägi/Scharloth 2005, 38).
2.2 Die schweizerische Standardsprache
Deutsch wird in der Forschung als plurizentrische Sprache beschrieben (vgl. Ammon 1995, 46ff.). Kloss definiert diesen Begriff wie folgt: „Hochsprachen sind besonders dort häufig plurizentrisch, d.h. weisen mehrere gleichberechtigte Spielarten auf, wo sie die Amts- und Verwaltungssprache mehrerer grösserer unabhängiger Staaten ist [sic!]“ (Kloss 1978, 67). Dabei nennt er Deutsch in der BDR, der DDR, der Schweiz und Österreich als Beispiel. Die Diskussion über die deutsche Sprache und ihre Rolle als Schweizer Standardsprache geht viele Jahre zurück. Während im mündlichen Bereich die Dialekte vorherrschend blieben (und bleiben), ersetzte im 16. bis 18. Jahrhundert die neuhochdeutsche Schriftsprache die regionalen Schreibsprachen. Als sich dann die neu etablierte Standardsprache in immer mehr Teilen des deutschen Raums auch zur Alltagssprache entwickelte, fürchtete man in der Schweiz den Untergang der Dialekte. Aus diesem Grund wurde versucht, die beiden Sprachformen strikt zu trennen (vgl. Hove 2002, 32), was zur allgemeinen Einstellung führte, dass die Mundart und die Standardsprache als zwei Sprachen betrachtet werden sollen, mit dem Recht, „rein gesprochen zu werden“ (Haas 2000, 84). Zu dieser Zeit „bedeutete ‚Reinheit’ soviel wie Anpassung an die sich in Deutschland durchsetzende Norm“ (Hove 2002, 32), besonders bezüglich der Aussprache der Standardsprache. Es galt „die Mundart und Standardsprache gleichermassen ‚rein’ und ‚unvermischt’ zu sprechen“ (Haas 2000, 83). Eine solche „nationsübergreifende Vereinheitlichung“ (Ammon 1995, 231) stiess sowohl auf Zustimmung als auch auf starken Widerstand und löste eine Diskussion über den Grad der Anpassung der Aussprache an die deutschländische Varietät aus. Heutzutage existieren zahlreiche Vorschläge zur bevorzugten Aussprache von Standarddeutsch in der Schweiz, die sich über die Jahre nicht gross verändert haben. Hove fasst die Entwicklungen wie folgt zusammen:
Verändert hat sich [...] die Einstellung gegenüber regional gefärbter Standardsprache. Während sie zu Beginn des Jahrhunderts als notwendiges Übel geduldet wurde, wird später immer häufiger das Recht auf eine schweizerische Varietät der Standardsprache, die unter anderem gewisse Eigenheiten auf der lautlichen Ebene aufweist, betont. (Hove 2002, 40)
Dabei scheint vor allem eine Frage von Bedeutung zu sein: Wie schweizerisch darf die gesprochene Standardsprache von Deutschschweizer:innen klingen oder wie ähnlich muss die Schweizer Aussprache am norddeutschen Vorbild liegen (vgl. Guntern 2012, 2)? Die Sprecher:innen können allerdings nicht individuell und willkürlich entscheiden, welche Varianten sie für die Standardsprache verwenden, „sondern es besteht innerhalb der Deutschschweiz eine recht weitgehende Übereinkunft darüber, welche Varianten für die schweizerische Standardsprache angemessen sind und welche nicht“ (Hove 2002, 6). Sie nennt diese Übereinkunft „schweizerhochdeutsche Sprachkonvention“ (Hove 2002, 6), die einen grösseren Einfluss auf die Wahl der Varianten hat, als beispielsweise der individuell gesprochene Dialekt. Die Varianten lassen sich laut Hove in drei Gruppen einteilen:
- Eindeutig dialektale Varianten, die nicht in der Standardsprache verwendet werden sollen (z.B. würde keine deutschschweizerische Person Huus beim Sprechen von Standarddeutsch verwenden).
- Eindeutig standardsprachliche Varianten, die nicht im Dialekt verwendet werden (z.B. ein aspiriertes <k> würden keine Deutschschweizer;innen im Dialekt verwenden, mit Ausnahme von Basler:innen und Bünder:innen (siehe Kapitel 2.4.2.)
- Ambige Varianten, die in beiden Varietäten vorkommen (z.B. die Affrikate <pf>, die sowohl im Dialekt als auch in der Standardsprache als [pf] ausgesprochen wird).
(vgl. Hove 2008, 65f.)
Die schweizerhochdeutsche Sprachkonvention bestimmt nun, wie und in welchen Kontexten die verschiedenen Varianten zu realisieren sind. Dabei gibt es pro Variante jedoch nicht nur eine Realisierungsmöglichkeit. Die Sprachkonvention lässt verschiedene zu, weshalb beim schweizerischen Standarddeutsch nicht von einer komplett homogenen Varietät gesprochen werden kann. Allerdings führt die Konvention dazu, dass sich „Mitglieder einer Sprachgemeinschaft viel einheitlicher verhalten, als sie es tun würden, wenn keine solche Konvention existierte“ (Hove 2000, 7). Während das Einhalten dieser sprachlichen Konventionen Gruppenzugehörigkeit ausdrückt, wird eine Abweichung von den geltenden Konventionen eher negativ als positiv angesehen. „Da alle Personen wissen, dass die Art, wie sie die Standardsprache aussprechen, interpretiert werden kann, versuchen sie, Varianten zu verwenden, die [...] positiv oder überhaupt nicht interpretiert werden“ (Hove 2002, 145) (siehe Kapitel 2.3). Dadurch, dass den Sprecher:innen schweizerische oder deutschländische Varianten bei der Realisierung von Standarddeutsch zur Verfügung stehen, ist es möglich, die Standardvarietät mit einer eher schweizerischen oder eher deutschländischen Färbung zu versehen. Dies führt zur Koexistenz von mehreren, unterschiedlichen ‚Hochdeutschs’ (vgl. Guntern 2012, 106f.). Hove geht davon aus, dass diese verschiedenen Hochdeutschregister hierarchisch gegliedert sind. Für informelle Kontexte werden eher Register mit dialektnahen Varianten verwendet, wobei für formellere Kontexte auf Register mit den von den Aussprachewörterbüchern vorgeschriebenen Lauten zurückgegriffen wird (Hove 2002, 13). Die Existenz von Idealvorstellungen der zu verwendenden Schweizerhochdeutschs führt zu sogenannten Hochdeutsch-Idealen. Diese „kommen durch den Kontakt des Individuums mit der Standardsprache in verschiedenen Situationen zustande“ und können definiert werden als „kontextabhängige Grössen, die durch das sprachliche Wissen der SprecherInnen geprägt sind“ (Guntern 2012, 111). In der Diskussion darüber, welche Varietät nun die empfehlenswerteste sei, wurde oft „die goldene Mittelstrasse“ (Stickelberger 1912, 3) genannt. Heinrich Stickelberger, der im Auftrag des 1904 gegründeten deutschschweizerischen Sprachverein sein Buch über die Aussprache des Hochdeutschen veröffentlichte, erklärte: „Wir brauchen in der Aussprache nicht jede schweizerische und selbst jede örtliche Eigenart abzulegen, denn in ihr liegt auch ein berechtigtes Stück unserer selbst“ (Stickelberger 1912, 5). Auch Bruno Boesch ist dieser Meinung. Er betont, dass „für die Schweiz eine Aussprache, die weder zu mundartlich noch eine unbedingte Nachahmung der Hochlautung in ihrer strengsten Form“ am idealsten ist (vgl. Boesch 1957, 15, zit. n.: Hove 2002, 38).
2.3 Spracheinstellungen
Einstellungen gegenüber Sprachen werden in der Soziolinguistik nicht nur aufgrund ihres Einflusses auf das soziale Verhalten untersucht (vgl. Lasagabaster 2004, 401), sondern auch wegen des Einflusses auf die Produktion und Rezeption von Sprache:
[…] so in terms of our everyday use of language, language attitudes would be expected not only to influence our reactions to other language users around us, but also to help us anticipate others’ responses to our own language use and so influence the language choices that we make as we communicate. (Garrett 2010, 21)
Attitüden setzen sich aus drei Komponenten zusammen: aus einer kognitiven, die mit Gedanken und Überzeugungen zu tun hat, aus einer affektiven, welche die Gefühle gegenüber beispielsweise einer Sprache betrifft, und aus einer konativen Komponente, die als unsere Verhaltensintention definiert ist (vgl. Lasagabaster 2004, 400). Jede Person urteilt bewusst oder unbewusst über das Verhalten und insbesondere über den Sprachstil der jeweiligen Gesprächspartner:innen und hat ebenfalls eine gewisse Vorahnung darauf, wie die eigene Sprache aufgenommen und bewertet wird (vgl. Hove 2002, 156). Einstellungen können jedoch nicht direkt gemessen werden. Oppenheim definiert sie als „inner component of mental life which expresses itself [...] through such more obvious processes as stereotypes and beliefs, verbal statements or reactions, ideas and opinions, selective recall, anger […] or some other emotion […]” (Oppenheim 1982, 39). Auch wenn mittlerweile diverse Erhebungsmethoden vorgestellt und verwendet wurden, können persönliche Einstellungen aufgrund ihrer Komplexität niemals komplett erfasst werden (vgl. Hove 2002, 156). Nichtsdestotrotz wurden schon viele Studien durchgeführt, welche die Spracheinstellungen der Deutschschweizer:innen gegenüber der Standardsprache darzulegen versuchten. Generell scheint das Verhältnis in der Deutschschweiz zur gesprochenen Standardsprache ambivalent zu sein, was sich beispielsweise in der Kritik über die Sprache von Schweizer Radio- und Fernsehsprecher:innen widerspiegelt:
Wenn eine Sprecherin tadelloses Bühnendeutsch spricht, heisst es, wir brauchten doch nicht dieses Deutschtum und Deutsch-Tun in unserem Radio; lässt sich aber ein Moderator mit einer gemässigten schweizerdeutschen Variante der Standardsprache hören, ist die andere Seite empört: Nun können nicht einmal mehr die Berufssprecher richtig Deutsch! (Schläpfer 1990, 194f.)
Dieses „gebrochene Verhältnis“ (Schläpfer 1991, 26) zur Standardsprache führt auch zu einem „damit verbundenen Unterlegenheitsgefühl“ (Schläpfer 1991, 26). Unter Deutschschweizer:innen wird die Standardsprache häufig mit der Varietät verglichen, die man glaubt, bei den Deutschen oder in den Medien wahrzunehmen. Dass man versucht, sich der Standardaussprache aus Deutschland anzupassen kommt von einer „fear of loss of social status when adopting the norms of the ND [non-dominant] –variety“ (Muhr 2018, 20). Clyne erklärt, dass sich daraus resultierend vor allem die kulturellen Eliten der dominanten Varietät, in diesem Fall der deutschländischen, angleichen, weil „more distinctive forms of national varieties [...] dialectally and sociolectally marked“ (Clyne 1991, 459) sind. Scharloth fand in seiner Wahrnehmungsstudie heraus, dass dies jedoch im Fall der Schweiz nicht nur auf die kulturelle Elite beschränkt ist, sondern eine generelle Mehrheit der Deutschschweizer:innen die schweizerischen Varianten als schlechtes oder fehlerhaftes Standarddeutsch empfinden (vgl. Scharloth 2005, 261).
Hove stellt fest, dass die gängige Überzeugung existiert, dass Menschen aus der Deutschschweiz sich zwar Mühe geben, die Standardsprache schön und richtig zu sprechen, dazu jedoch nicht in der Lage sind, weshalb die Standardsprache eben mit dialektalen Lauten artikuliert wird (vgl. Hove 2002, 6). Haas drückt dies wie folgt aus: „Wir besitzen [...] nicht einfach eine abweichende mündliche Standardsprache, wir besitzen in der Standardsprache überhaupt kein mündliches Register, in welchem wir uns selber wohl fühlen würden“ (Haas 2000, 107). Schläpfer et al. unterstützen diese Annahme und halten fest, dass die Abnahme der Kontexte, in denen die Standardsprache gesprochen wird, zu fehlender Praxis führt und man sich deswegen nicht korrekt ausdrücken kann (vgl. Schläpfer et al. 1991, 82). Zusätzlich zu den abwesenden Gebrauchskontexten von Hochdeutsch kommt die allgemeine Einstellung ‚Standarddeutsch wird in der Deutschschweiz nicht gerne gesprochen’ hinzu, die sich als Stereotyp etabliert hat (vgl. Christen et al. 2010, 15).
Eine der grössten Studien zu den Spracheinstellungen der Deutschschweizer:innen gegenüber der Standardsprache führten 1991 Robert Schläpfer, Jürg Gutzwiler und Beat Schmid durch. Insgesamt werteten sie 1982 Fragebögen über den sozialen Hintergrund, den Fremdspracherwerb, das Sprachverhalten und die Spracheinstellung bezüglich Mundart und Standardsprache von jungen Rekruten aus dem Jahr 1985 aus. Die Ergebnisse unterstützen das oben angesprochene ambivalente Verhältnis. 68,1 % der Rekruten geben an, dass die Aussage Deutschschweizer sprechen nicht gern Hochdeutsch zutrifft, was auf eine ziemlich starke Unbeliebtheit der Standardsprache als Sprechsprache bei den Rekruten und – insofern ihre Beobachtungen zutreffen – auch bei Deutschschweizer:innen allgemein hinweist. Widersprüchlich dazu sind jedoch 56,3 % der Meinung, Standarddeutsch zu sprechen mache ihnen nichts aus und 20,3 % finden sogar, es mache ihnen Spass. Die Aussage, Wenn ich Hochdeutsch spreche, komme ich mir dumm vor, bewerten 63,3 % als nichtzutreffend. Dies unterstützt die Annahme, dass es sich lediglich um einen Stereotypen handelt, dass Standarddeutsch bei allen Deutschschweizer:innen unbeliebt ist (vgl. Hove 2002, 160). Die Rekruten wurden überdies gefragt, wie Deutschschweizer:innen ihrer Meinung nach Hochdeutsch sprechen sollen. 81 % sind der Meinung man darf hören, dass eine Person beim Sprechen der Standardsprache aus der Schweiz stammt. Nur 16,8% gaben an, dass man möglichst wie Deutsche sprechen soll. Bei der Beurteilung der Deutschen bezüglich Sympathie geben 55,9 % an, sie unsympathisch oder eher unsympathisch zu finden, während 25,8 % sie als eher sympathisch und 13.2 % als sympathisch empfinden. Zudem empfinden 40 % der Befragten den Unterschied zwischen Deutschen und Schweizer:innen als gross, was den Versuch sich von den nördlichen Nachbarn abzugrenzen, verdeutlicht. Bis auf einige Ausnahmen definiert zudem niemand Hochdeutsch als Muttersprache, was Schläpfer et al. darauf schliessen lässt, dass sich die Mehrheit der Gewährspersonen beim Sprechen der Standardsprache weniger sicher fühlen als beim Sprechen des Dialektes. Des Weiteren sind die meisten Rekruten der Meinung, dass der Dialektgebrauch in der Schule erweitert werden soll. Jedoch wird die Notwendigkeit die Standardsprache sprechen und verstehen zu können, von den meisten Rekruten trotzdem erkannt. Schläpfer et al. Stellten fest, dass die Bildung der Rekruten der wichtigste Faktor bezüglich den Einstellungen gegenüber der Standardsprache ist. „Bis auf wenige Ausnahmen gilt, dass den Kenntnissen in der Hochsprache um so mehr Bedeutung zugemessen wird und der Gebrauch um so häufiger ist, je höher die absolvierte Schulstufe der Probanden ist“ (Schläpfer et al. 1991, 213).
Annelies Häcki Buhofer und Thomas Studer untersuchten 1993 die Attitüden von Vorschulkindern, Erst- und Zweitklässlern. Während die Standardsprache von den Kindern in der ersten Klasse noch deutlich positiver betrachtet wird, hat sie bei den Kindern in der zweiten Klasse ihre Attraktivität und Integrität fast vollständig verloren. Grund dafür könnte die anfängliche Neugierde und Offenheit gegenüber der neuen Schulsituation allgemein sein. Ihre Studie zeigte, dass die Kinder bereits im Kindergarten „ein gutes Sprachdifferenzbewusstsein für die Varianten der deutschen Sprache, allen voran für ihr eigenes Schweizerdeutsch (das Zürichdeutsche) und für das Hochdeutsche (sei es schweizerischer oder bundesdeutscher Prägung) haben“ (Häcki Buhofer/Studer 1993, 196).
Auch Hove führte im Anschluss an ihre Untersuchungen über die Aussprache junger gebildeter Deutschschweizer:innen eine Studie über die Spracheinstellungen von 31 Gewährspersonen durch. 14 Befragte geben an, gerne Standarddeutsch zu sprechen, während es zwölf nichts ausmacht und nur fünf sagen, dass sie es nur ungern sprechen. Die Frage welches Hochdeutsch das bessere sei, beantworten zwölf Personen mit deutschem Hochdeutsch, zwei mit schweizerischem Hochdeutsch und zehn meinen es sei nicht beantwortbar. Überraschenderweise sind jedoch 14 Befragte der Meinung, dass es unsympathisch ist, wenn Schweizer:innen deutschländisches Deutsch sprechen. Sechs finden es sogar sehr unsympathisch. Das Verhältnis zur Standardsprache „scheint geprägt von einem Minderwertigkeitsgefühl gegenüber den Deutschen einerseits [zu sein], andererseits aber gleichzeitig von der Überzeugung, dass für SchweizerInnen schweizerisches Hochdeutsch angemessen ist“ (Hove 2002, 159).
Diese widersprüchlichen Ergebnisse gleichen den Resultaten aus Joachim Scharloths Untersuchung aus dem Jahr 2006. Sein Ziel war es, die Einstellungen gegenüber schweizerhochdeutschen Varianten zu erfassen. Er bat 35 Gewährspersonen vorgelesene Sätze von deutschen und Schweizer Sprecher:innen nach Korrektheit zu bewerten. Dabei werden 72% der Sätze, die schweizerische Varianten wie Helvetismen beinhalteten, als fehlerhaftes oder sogar schlechtes Standarddeutsch eingestuft. Dies zeigt, dass Deutschschweizer:innen die schweizerischen Standardformen und –varianten allgemein schlechter bewerten als die deutschländischen (vgl. Scharloth 2006).
2.4 Literatur zur Aussprache des Schweizerhochdeutschen
Präskriptive Arbeiten zur schweizerischen Standardaussprache sind seit dem 19. Jahrhundert viele entstanden. In seinem umfangreichen Buch über die Standardsprache und ihre Varietäten in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern erläutert Ammon (1995) die wichtigsten Kodexteile zur Aussprache von Standarddeutsch in der Schweiz. Dazu gehört Boesch (1957), der für die Schweiz eine Aussprache verlangt, die weder zu dialektal noch zu deutschländisch geprägt ist, die 19. Auflage des Siebs (1969), der erstmals zwischen reiner und gemässigter Hochlautung unterschied, Meyer (1989), der zu grössten Teilen mit Siebs und Boesch übereinstimmt, und Burri et al. (1993), welche die Aussprache von Dialekt und Standardsprache in den Medien behandeln.2 Die umfangreichste empirische Untersuchung zur Lautung ist jedoch die Arbeit von Ingrid Hove aus dem Jahr 2002, die auch für die vorliegende Masterarbeit am relevantesten ist. Sie führte eine umfassende empirische Studie zur Aussprache der Standardsprache in der Schweiz durch. Ihr Ziel war es, die Aussprache in formellen Situationen junger und gebildeter Deutschschweizer:innen zu beschreiben. Als Korpus dient ihr die Sprache von insgesamt 57 Gewährspersonen. Er gliedert sich in zwei Teile: Während 31 Proband:innen eine Kurzgeschichte vorlasen, wurde die spontan gesprochene Standardsprache von 26 Schüler:innen während eines Gesprächs aufgenommen. Die für die vorliegende Arbeit bedeutendsten Ergebnisse über die Charakteristika der Schweizer Standardaussprache werden im Kapitel 2.5. vorgestellt.
Helen Christen, Manuela Guntern, Ingrid Hove und Marina Petkova führten 2010 eine weitere umfassende empirische Untersuchung zur gesprochenen Standardsprache in der Schweiz durch. Ihr Ziel war es, die Realisierung der Standardsprache nicht in normorientierten, sondern in verständigungsorientierten Kontexten zu erfassen und zu beschreiben. Als Korpus dienen ihnen Aufnahmen von Polizeinotrufen. Insgesamt beinhaltet er 468 Gespräche mit allochthonen (nicht heimischen) Gesprächspartner:innen. Auch ihre Ergebnisse werden im Kapitel 2.5. näher erläutert.
Beat Siebenhaar untersuchte die schweizerische Aussprache von Standarddeutsch 1994 anhand einer Wortliste, die von zufällig ausgewählten, vor allem jüngeren Personen in und aus Bern, Zürich und St. Gallen vorgelesen wurden. Ihre Aussprache wird bezüglich ihres dialektalen Hintergrundes diskutiert.
Jean-Pierre Métral führte 1971 eine Untersuchung zur Aussprache des Standarddeutschen von Bewohnern der Stadt Saanen im Berner Oberland durch. Er stellte das phonologische System des Dialekts den in Aussprachewörterbüchern empfohlenen Realisierungen gegenüber. Die Abweichungen werden von ihm negativ bewertet und nennt das Schweizerhochdeutsche einen „semi-dialecte“ (Métral 1971, 41, zit. n.: Hove 2002, 15).
2.5 Literatur zum Einfluss auf die Aussprache
In der Soziolinguistik wurde in den vergangenen Jahren versucht, den Auslösern für sprachliche Variation auf den Grund zu gehen. Neben aussersprachlichen Faktoren wie Alter, Geschlecht, soziale Klasse und Bildung spielen auch situative Normen und Konventionen, sowie Faktoren wie soziale Verhaltensweisen und Einstellungen gegenüber sprachlichen Differenzierungen eine Rolle (vgl. Schönfeld 1985, 221). Einflüsse soziodemografischer Daten auf die Aussprache von Standarddeutsch in der Schweiz wurden jedoch bisher kaum behandelt. Einzig Hove geht in ihrer Arbeit in wenigen Sätzen auf die möglichen Einwirkungen der Metadaten auf die Aussprache ein.
2.5.1 Geschlecht
Unterschiede der Sprache hinsichtlich des Geschlechts der Sprecher:innen ist ein wiederkehrender Fokus in der Soziolinguistik. Labov formulierte 1990 ein Prinzip, das mittels zahlreichen Studien bewiesen werden konnte: „For stable sociolinguistic variables, men use a higher frequency of nonstandard forms than women“ (Labov 1990, 210). So zeigt beispielsweise die Studie von Trudgill in Norwich, England, dass Frauen häufiger die prestigeträchtigere Variante [ŋ] im Suffix <-ing> verwenden, während die Männer eher [n] gebrauchen (vgl. Trudgill 1974). Das gleiche konnte ebenfalls in New York City (vgl. Labov 1966), Detroit (vgl. Wolfram 1969), Philadelphia (vgl. Cofer 1972) und vielen weiteren englischsprechenden, wie auch in anderssprachigen Regionen nachgewiesen werden (vgl. Labov 1990, 211ff.). Labov erklärt diese Erkenntnisse wie folgt:
Most of the emphasis is on the behavior of women, who are said to be more expressive than men or use expressive symbols more than men or rely more on such symbols to assert their position. This in turn is linked to differential power relationships of men and women. Women are said to rely more on symbolic capital than men because they possess less material power. (Labov 1990, 214)
Die Erkenntnis, dass Frauen eher zu konservativen und standardnahen Formen tendieren, um den prestigeträchtigen Status Quo zu erhalten, widerspricht jedoch der Beobachtung, dass Frauen auch als „linguistic innovators in linguistic change“ (Labov 1990, 205) agieren. Hove widmet sich in ihrer Untersuchung von 2002 nur kurz den aussersprachlichen Faktoren, die einen Einfluss auf die Art und Weise der Aussprache von Standarddeutsch in der Schweiz haben können. Bezüglich des Faktors Geschlecht stellt sie fest, dass Frauen sich stärker am Mediendeutschen orientieren als Männer, was sie mit der prozentual deutlich höheren Anzahl Vokalisierungen des r -Lautes begründet. Jedoch liefert ihr Korpus keine Beweise für klare geschlechtsspezifische Unterschiede. Sie schliesst einen Zusammenhang des Geschlechts mit der Aussprache des Standarddeutschen zwar nicht aus, ist jedoch der Meinung, dass diese Unterschiede eher gering sind (vgl. Hove 2002, 141).
2.5.2 Alter
Hinsichtlich des Faktors Alter konnte festgestellt werden, dass jüngere Personen Sprachwandel allgemein vorantreiben. So zeigen viele Studien über den Sprachwandel der Schweizer Dialekte, dass jüngere Personen nicht nur zu „sprachgeografisch weiter verbreiteten Formen tendieren“ (Juska-Bacher 2010, 33), sondern auch zu standardnäheren Varianten (vgl. z.B. Hofer 1997, Juska-Bacher 2010, Wolfensberger 1967).
In Hoves Arbeit wird bemerkt, dass aufgrund der Tatsache, dass die Standardaussprache von nur fünf über 50-jährigen Gewährspersonen erhoben wurde, keine aussagekräftigen Beobachtungen gemacht werden können. Sie stellt jedoch fest, dass die älteren Proband:innen die Buchstabenverbindung <chs> im Wort Sechser ausnahmslos mit einem ks -Laut realisiert wurde, genauso wie die Nachsilbe <-ig> immer als [ɪg] oder [ɪk] ausgesprochen wurde. Ebenfalls fällt der Vokal in der Nachsilbe <-en> auf, der bei den älteren Gewährspersonen in 77 % der Fälle artikuliert wird, was bei den jüngeren in nur 55 % der Fälle vorkommt. Abgesehen davon kann Hove keine Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen feststellen, was hinsichtlich des stetem zeitlichen Wandels unterlegenen Aussprachekonvention (siehe Kapitel 2.2) überraschend ist. Sie vermutet jedoch,
dass sich der Wandel der Aussprachekonvention in der realen Zeit nicht so eins zu eins in den Altersgruppen spiegelt, wie dies in der Sprachwandelforschung oft angenommen wird, sondern dass sich die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft der Aussprachekonvention fortlaufend anpassen. (Hove 2002, 140)
2.5.3 Bildung und soziale Klasse
Viele Studien über sprachliche Variation beschäftigen sich auch mit dem Einfluss der sozialen Klasse auf die Wahl linguistischer Varianten. ‚Social class’ bedeutet hierbei „a composite of education, occupation and income“ (De los Heros Diez Canseco 1997, 10f.). Labov fand 1966 beispielsweise heraus, dass Personen aus der Upper Middle Class mehr standardnahe Varianten benutzen als Personen aus der Working Class (vgl. Labov 1966), was ebenso von Trudgill (1974) beobachtet wurde. Wie bereits in der Einleitung thematisiert, herrscht in der Schweiz die allgemeine Auffassung vor, dass eine zu schweizerisch klingende Aussprache von Hochdeutsch ein Zeichen fehlender Bildung ist. Als prototypisch gelten dabei beispielsweise die Realisierung eines <k> als kratziges [kx] oder eines [x] für <ch>, das laut deutschländischer Aussprachenorm in gewissen Umgebungen ein [ç] verlangt. In Hoves Untersuchung kommen diese Artikulationen bei den gebildeten Sprecher:innen selten vor. Aufgrund der ausschliesslich gebildeten Gewährspersonen in ihrer Studie vergleicht sie die Ergebnisse mit denen von Métrals Studie, die einen niedrigeren Bildungsgrad aufweisen:
Weil sie die langen Mittelzungenvokale offen als [ɛː], [ɔː] und [œː] aussprechen und den mit <ä> geschriebenen Laut als [æː] realisieren, liegt die Vermutung nahe, dass die Realisierung dieser Variablen mit dem Bildungsgrad oder der Schichtzugehörigkeit der SprecherInnen zusammenhängt. (Hove 2002, 141)
2.5.4 Spracheinstellungen
Wie im Kapitel 2.3 bereits erläutert, können Spracheinstellungen einen Einfluss auf die Rezeption und vor allem auch Produktion von Sprache haben:
Vermutet ein Sprecher, dass auf bestimmte phonetische Merkmale, Aussprachen oder Intonationen mit Abneigung, Abwehr oder gar sozialer Verachtung reagiert wird, so wird er solche negativ beladenen Sprechweisen zu vermeiden versuchen. Einstellungen und Vorurteile können [...] auch gegenüber innersprachlichen Varianten (Subcodes), regionalen Dialekten oder einzelnen sprachlichen Merkmalen, die sozial (soziolektal) markiert sind wie Zungen-r, Nasalierungen, überoffene Vokale, Vokalisierungen von Konsonanten, Archaismen, Regionalismen etc. [beobachtet werden]. (Löffler 1985, 44)
[...]
1 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dies im Sinne der geschlechtergerechten Sprache als Deutschschweizer:innen formuliert.
2 Für einen ausführlichen Überblick der präskriptiven Arbeiten über die schweizerische Standardaussprache siehe Hove 2002, 14ff. und 32ff. sowie Ammon 1995, 231ff.
- Quote paper
- Corinne Lanthemann (Author), 2021, Der Einfluss des soziodemografischen Hintergrundes auf die Aussprache von Standarddeutsch in der Deutschschweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1161109
Publish now - it's free















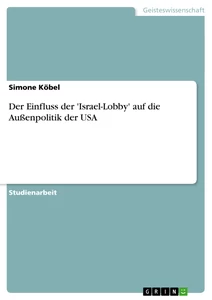




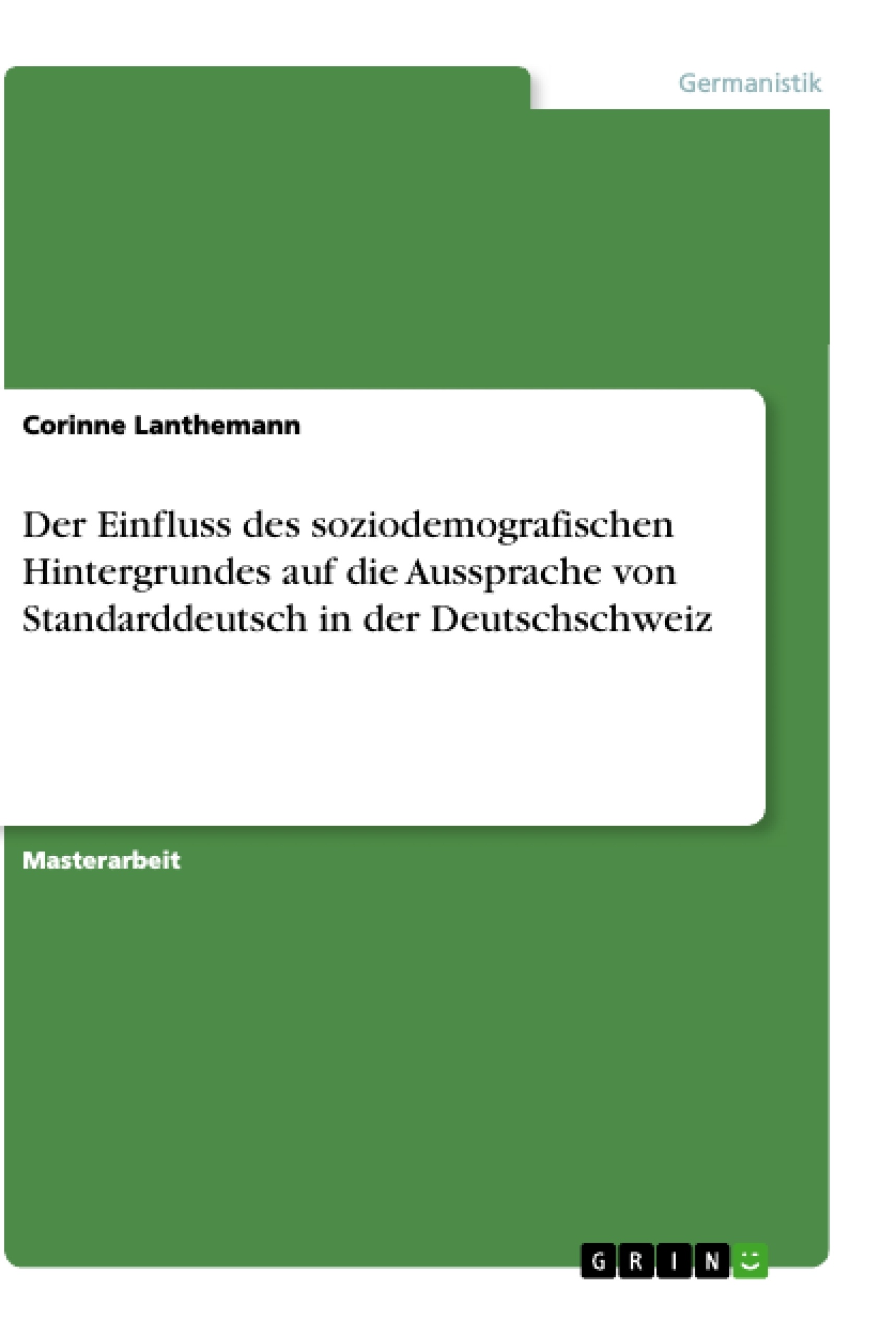

Comments