Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Forschungsinteresse
1.2 Forschungsdesign
1.3 Aufbau der Masterthesis
2 Der Mensch als „Objekt“ – im psychiatrischen System
2.1 Was ist die Psychiatrie
2.2 Geschichte der Psychiatrie
2.3 Behandlungsgrundlage und Therapieformen
2.3.1 Diagnostik und Krankheitsverständnis
2.3.2 Psychopharmakotherapie und Psychotherapie
2.4 Institutionelle Rahmenbedingungen
2.4.1 Aufgaben und rechtliche Rahmenbedingungen
2.4.2 Macht, Zwang und Gewalt
2.4.3 Exkurs: Ökonomische Einflüsse
Zwischenfazit: Der Mensch als Objekt
3 Der Mensch als Subjekt – im personzentrierten Ansatz
3.1 Wurzeln des personzentrierten Ansatzes
3.2 Philosophische Grundlagen und Menschenbild
3.3 Persönlichkeitstheorie
3.4 Störungstheorie / Carl Rogers Verhältnis zur Diagnostik
3.5 Beratungs- und Therapietheorie
Zwischenfazit: Der Mensch als Subjekt
4 Subjektorientierung in der (Gemeinde-)Psychiatrie
4.1 Der Paradigmenwechsel
4.1.1 Anthropologische Psychiatrie
4.1.2 Die Antipsychiatrie
4.1.3 Die Psychiatriereform
4.1.4 Exkurs: Soteria
4.2 Die Gemeindepsychiatrie
4.2.1 Warum Gemeindepsychiatrie?
4.2.2 Der gemeindepsychiatrische Verbund
4.2.3 Subjektorientierte Behandlungsansätze
4.3 Das Herner Modell
4.3.1 Verzicht auf Aufnahmestationen und Offene Türen
4.3.2 Heterogenität
4.3.3 Das Atelier
4.3.4 Die Delegiert_innen/ Krisenassistent_innen
4.3.5 Das Jakobus Weg Projekt
5 Auswertung und kritische Reflexion
5.1 Auswertung
5.2 Kritische Reflexion der Ergebnisse
6 Fazit und Ausblick
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die vorliegende Masterthesis behandelt das Thema „Vom Objekt zum Subjekt – die (Gemeinde-)Psychiatrie vor dem Hintergrund des personzentrierten Ansatzes am Beispiel der Stadt Herne“. In der nachfolgenden Einleitung wird zunächst das Forschungsinteresse dieser Untersuchung skizziert. Anschließend werden das Forschungsdesign und die Ziele erläutert, um abschließend den Aufbau dieser Masterthesis darzulegen.
1.1 Forschungsinteresse
Mein besonderes Interesse an dieser Untersuchung leitet sich vor allem aus meinem beruflichen Kontext und entsprechenden Bezügen zum Thema ab. Ich selbst arbeite seit mehreren Jahren im „Ambulant Betreuten Wohnen“ des Caritasverbandes in Herne und stehe als Sozialpädagoge vor allem dem Personenkreis chronisch psychisch erkrankter Menschen zur Seite. Im „Ambulant Betreuten Wohnen“ – als Teil der Gemeindepsychiatrie – bin ich in meiner betreuenden, beratenden und oft auch koordinierenden Tätigkeit auf vielfältige Weise im psychiatrischen Verbund vernetzt. Sowohl das „psychiatrische System“ im Allgemeinen – mit seinen speziellen Richtlinien und Abläufen – als auch die psychiatrische Klinik im Speziellen – als wichtige Anlaufstelle für viele meiner Klient_innen – stellt einen wesentlichen Bezugspunkt meiner täglichen Arbeit dar.
Auf Grund meines großen Interesses an dem Arbeitsfeld der Psychiatrie, seiner wechselhaften Geschichte und fortschreitenden Entwicklung, möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, diese zwei für mich wichtigen „Lebenswelten“ – mein Studium des personzentrierten Ansatzes auf der einen Seite und meine Arbeit in der Gemeindepsychiatrie auf der anderen Seite – zusammenzuführen.
Durch eine intensive Auseinandersetzung im Rahmen dieser Masterthesis erhoffe ich mir zudem ein besseres und vertieftes Verständnis eigener Arbeitszusammenhänge und mehr Kongruenz im Hinblick auf entsprechende Ambivalenzen. In vielen kritischen Beiträgen zur Psychiatrie erhält man schnell den Eindruck, dass es sich bei der Psychiatrie um ein „menschenfeindliches“ und somit wenig personzentriertes System handelt. Demgegenüber stehen aber auch Konzepte, vor allem in der Gemeindepsychiatrie (in Herne), die sich sehr personzentriert darbieten und entsprechend ambitioniert wirken. Mein Anliegen ist es, mich mit dieser Ambivalenz des psychiatrischen Systems näher auseinanderzusetzen.
1.2 Forschungsdesign
Das Ziel dieser Untersuchung ist es, die (Gemeinde-)Psychiatrie vor dem Hintergrund des personzentrierten Ansatzes zu analysieren.
Die Forschungsfrage dieser Untersuchung lautet: Wie stellt sich die Entwicklung der (Gemeinde-)Psychiatrie vor dem Hintergrund des personzentrierten Ansatzes dar und welche Bezüge lassen sich zwischen dem personzentrierten Ansatz und der (Gemeinde-) Psychiatrie – im Hinblick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten – herstellen. Es soll vor allem der Frage nachgegangen werden, welche (gemeinde-)psychiatrischen Entwicklungen sich im Hinblick auf eine subjektorientierte – an dem personzentrierten Ansatz angelehnten – Psychiatrie identifizieren lassen.
Mein Untersuchungsmaßstab ist der personzentrierte Ansatz. Meinen Untersuchungsgegenstand bildet, wie bereits angedeutet, die (Gemeinde-)Psychiatrie.
Bei einer ersten Recherche zu diesem Thema stellte ich (überraschenderweise) fest, dass der personzentrierte Ansatz nach Carl Rogers als auch C. Rogers selbst in der Psychiatrie nur selten explizit Erwähnung findet. Somit besteht die Herausforderung dieser Untersuchung vor allem darin, den personzentrierten Ansatz zu dem Untersuchungsgegenstand der (Gemeinde-)Psychiatrie in Bezug zu setzen. Da es sich bei dem personzentrierten Ansatz in erster Linie um einen Beratungs- und Therapieansatz handelt, die Psychiatrie hingegen unter anderem in ihrer konzeptionellen Vielfalt betrachtet werden soll, wird der personzentrierte Ansatz und seine impliziten – über das konkrete Beziehungsangebot hinausgehenden – (anthropologischen) Annahmen, auf das psychiatrische System übertragen. Wie bereits der Titel dieser Masterthesis konstatiert, soll hierbei besonders die dem personzentrierten Ansatz implizite, sich um Subjektorientierung bemühende Sichtweise auf den Menschen in den Fokus der Untersuchung rücken. Die Subjektorientierung – als Gütekriterium des personzentrierten Ansatzes – bildet den einen Pol der Untersuchung, dessen Gegenpol der Mensch als Objekt – mit all seinen im Rahmen der Untersuchung weiter aufgeführten Implikationen – entgegensteht. Zwischen diesen beiden Polen sollen in der vorliegenden Untersuchung die verschiedenen Ansätze und Strukturen der (Gemeinde-) Psychiatrie positioniert und reflektiert werden.
Bei der vorliegenden Masterthesis handelt es sich um eine Untersuchung auf der Grundlage einer umfangreichen Literaturanalyse. Diese literaturbasierte Analyse wird ergänzt durch meine persönliche, langjährige Berufserfahrung in der Gemeindepsychiatrie.
Die Hypothese der vorliegenden Untersuchung lautet, dass in der (Gemeinde-) Psychiatrie die Entwicklung von einer Objektorientierung zu einer Subjektorientierung zu erkennen ist, die sich anhand der personzentrierten Grundsätze untersuchen und begründen lässt.
Diese Hypothese findet ihren Niederschlag bereits im Titel dieser Masterthesis („Vom Objekt zum Subjekt“) und legt zu Grunde, dass sich in der geschichtlichen Entwicklung der Psychiatrie eine entsprechende Entwicklungstendenz erkennen lässt. Zudem findet sie ihren Niederschlag auch in der Gliederung der vorliegenden Masterthesis. Objektorientierung und Subjektorientierung bilden zunächst die beiden tendenziellen Zuordnungen zur traditionellen Psychiatrie („Der Mensch als Objekt“) und zum personzentrierten Ansatz („Der Mensch als Subjekt“), die im weiteren Verlauf überprüft werden sollen. Objektorientierung steht zu diesem Zeitpunkt zunächst stellvertretend für Alles, was den Menschen in seinem individuellen Erleben missachtet. Subjektorientierung hingegen wendet sich dem Menschen in seiner Einmaligkeit und seinem individuellen Erleben zu. Im weiteren Verlauf der Untersuchung sollen beide Begriffe mit „Leben“ gefüllt, am Ende der jeweiligen Kapitel zusammenfassend dargestellt und einander gegenübergestellt werden.
1.3 Aufbau der Masterthesis
Im Anschluss an die Einleitung wird im ersten inhaltlichen Kapitel 2 das traditionelle psychiatrische System vorgestellt. Nach einer grundlegenden Einführung in die Psychiatrie wird der historische Verlauf der Psychiatrie skizziert. Neben der Behandlungsgrundlage und den Therapieansätzen der traditionellen Psychiatrie, richtet sich der Blick zudem auf ihre institutionellen Rahmenbedingungen und die besonderen – zu bewältigenden – Herausforderungen der Psychiatrie.
Im Anschluss an die Gegenstandsbeschreibung der traditionellen Psychiatrie wird in Kapitel 3 – als Gegenpol zur tendenziell objektivierenden Psychiatrie – der personzentrierte Ansatz als originär subjektorientiert ausgerichteter Ansatz und als Untersuchungsmaßstab für die weitere Untersuchung in Kapitel 4 vorgestellt. In Kapitel 3 werden zudem Bezüge zur vorangestellten Psychiatrie aus Kapitel 2 hergestellt, indem der personzentrierte Ansatz zum traditionellen psychiatrischen System positioniert wird.
Im daran anknüpfenden Kapitel 4 werden die (gemeinde-)psychiatrischen Entwicklungen der reformierten Psychiatrie vorgestellt und vor dem Hintergrund des personzentrierten Ansatzes auf ihre Subjektorientierung hin überprüft. Ebenso wird in diesem Kapitel die psychiatrische Entwicklung exemplarisch am Beispiel der Stadt Herne – „dem Herner Modell“ – untersucht und veranschaulicht.
Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und zur Diskussion gestellt.
In einem Fazit werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst und als Ausblick weiterführende Anknüpfungspunkte für eine vertiefte Auseinandersetzung angeboten.
2 Der Mensch als „Objekt“ – im psychiatrischen System
Im folgenden Kapitel wird das psychiatrische System in seinen Grundzügen vorgestellt. Der Blick richtet sich hierbei vor allem auf die „traditionelle“ Psychiatrie und ihre den Menschen objektivierenden Anteile. Zu Beginn wird einleitend dargestellt, worum es sich bei der Psychiatrie ganz grundlegend handelt. Anschließend wird die wechselhafte Geschichte der Psychiatrie anhand ihrer wesentlichen Markierungspunkte vorgestellt, um dann die vorherrschende Behandlungsgrundlage und das Therapieverständnis der traditionellen Psychiatrie darzulegen. Im Anschluss daran folgt eine Beschreibung der institutionellen Rahmenbedingungen, abgerundet durch einen Exkurs zu aktuellen ökonomischen Einflüssen auf die Psychiatrie.
2.1 Was ist die Psychiatrie
Der Begriff Psychiatrie setzt sich aus den beiden griechischen Bezeichnungen psyche = Seele und latreia = Heilkunde zusammen und bedeutet somit wörtlich übersetzt Seelenheilkunde. Der Begriff Psychiatrie wurde von dem Mediziner J.C. Reil zu Beginn des 19. Jahrhunderts geprägt, setzte sich aber erst Mitte des vorletzten Jahrhunderts durch. Die Psychiatrie beschäftigt sich hauptsächlich mit Störungen, bei denen Erlebens- und Verhaltensänderungen im Vordergrund stehen. Hierbei unterscheidet sie sich auch von der ihr nahestehenden Neurologie, die sich im Gegensatz zur Psychiatrie auf die körperlichen Störungen des zentralen und peripheren Nervensystems beschränkt (vgl. Hell 2011, S. 15).
Die Psychiatrie kann als der Bereich der Medizin definiert werden, der sich mit der Erkennung (Diagnose), Behandlung (Therapie) und Prävention von seelisch-geistigen (psychischen) Störungen und Erkrankungen beschäftigt (vgl. Neuhäuser 2010, S. 7).
Seelische Störungen können durch psychische, soziale und auch körperliche Einflüsse – das heute vorherrschende bio-psycho-soziale Krankheitsmodell – entstehen. Körper und Seele befinden sich in einer engen Wechselwirkung zueinander. Die traditionelle Psychiatrie ist in erster Linie medizinisch-ärztlich ausgerichtet, wobei sich in der Praxis zunehmend eine enge Kooperation mit verschiedenen Fachdisziplinen (z.B. Soziale Arbeit, Psychologie) als notwendig erwies (vgl. Neuhäuser 2010, S. 7).
2.2 Geschichte der Psychiatrie
Die Geschichte der Psychiatrie reicht – je nach Interpretation und Auslegung der Psychiatriehistorie – bis in die Antike zurück (vgl. Neuhäuser 2010, S. 11). Erwin Ackerknecht sieht den Beginn der Psychiatriegeschichte bei den Griechen, wo die wissenschaftliche Medizin ihren Anfang genommen hat. Die Zeit darauf erachtet er als „zwei Jahrtausende umfassenden Stillstand“ (Ackerknecht 1985, S. 9), bis schließlich im 18. Jahrhundert unter dem Einfluss der Aufklärung die Psychiatrie zur selbständigen Wissenschaft wurde (vgl. Ackerknecht 1985, S. 10). Noch reduzierter drückt es Edward Shorter in seiner Geschichte der Psychiatrie aus: „Vor dem Ende des 18. Jahrhunderts gab es keine Psychiatrie“ (Shorter 1999, S. 4).
Erste Hinweise auf psychiatrische Erkrankungen findet man jedoch bereits unter den ersten beschriebenen und dokumentierten Erkrankungen. Ein bekanntes Dokument ist das Ebert Papyrus von 1900 v. Chr., in dem sich beispielsweise spezifische Hinweise auf Depressionen finden. Bereits in der Antike wurde eine vollständige Klassifizierung psychischer Erkrankungen erarbeitet – sowohl römische als auch griechische Ärzt_innen erkannten diese Störungen, rätselten aber vor allem über deren Ursache. Der römisch-griechische Standpunkt war im Hinblick auf psychische Krankheiten bereits sehr aufgeklärt. Nach der Auseinandersetzung der Griech_innen folgten nahezu 2000 Jahre ohne nennenswerte Fortschritte. Vor allem im Mittelalter änderte sich die Situation hingegen dramatisch. Psychische Erkrankungen wurden in dieser Zeit oft als gerechte Strafe oder göttliches Eingreifen verstanden und psychisch Kranke als von Teufel_innen oder von Dämon_innen besessen. Betroffene wurden in sogenannten „Narrenkäfigen“ öffentlich zur Schau gestellt oder als Hexen und Zauberer von der Inquisition verfolgt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt (vgl. Andreasen 1993, S. 3). Der Umgang mit den psychisch Erkrankten ist – das wird bereits an dieser Stelle deutlich – stets im Kontext der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung und dem jeweiligen Zeitgeist zu betrachten.
Eine erste Wende zeichnete sich in der Renaissance ab. 1586 wurde schließlich das erste Lehrbuch über psychische Erkrankungen – „Die Abhandlung über die Melancholie“ von Timothy Bright – verfasst. Er bezeichnete psychische Erkrankungen als „natürliche Verwirrungen“. Während des 17. und 18. Jahrhunderts fand man als „Alternativlösung“ für den Umgang mit psychisch Kranken die Unterbringung Betroffener in Krankenhäusern, den damaligen „Irrenanstalten“. Von einer humanen und subjektorientierten Behandlung hätte man auch in dieser Zeit nicht weiter entfernt sein können. Personen wurden eingesperrt, angekettet und von Kriminellen nicht wesentlich unterschieden. In der Aufklärung wurden dann weitere Schritte in der Behandlung psychisch Kranker gemacht. Benjamin Rush, ein amerikanischer Arzt, gründete die erste psychiatrische Einrichtung in den USA. In Europa wurde diese Bewegung fortgesetzt. Philippe Pinel (1745-1826), ein Führer der französischen Revolution, gilt hierbei meist als Begründer der „modernen“ Psychiatrie (vgl. Andreasen 1993, S. 4 ff.). Als Arzt kam es ihm darauf an, die Krankheit des Einzelnen genau zu analysieren und die geeignete Therapie abzuleiten. Pinel war für feste und klare Regeln innerhalb der damaligen „Irrenanstalten“, bei der er trotz aller Strenge auf die unantastbaren Menschenrechte zu achten versuchte (vgl. Schott 2006, S. 60- 61).
Zwischen den psychiatrischen Entwicklungen – angestoßen durch die französische Schule – um 1800 und den Aufsehen erregenden Entwicklungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch Sigmund Freud, Emil Kraepelin und Eugen Bleuler, hat vor allem Wilhelm Griesinger (1817- 1868) in der Mitte des 19. Jahrhunderts großen Einfluss auf die Psychiatrie ausgeübt. Griesinger war ein wesentlicher Vorreiter der Sozialpsychiatrie. In seiner „Magna Charta zur Psychiatrie“ (Schott 2006, S. 168), der „Pathologie und Therapie psychischer Krankheiten“ (Giesinger 1845) fasste Griesinger bereits alle wesentlichen Problembereiche der Psychiatrie zusammen und entwickelte zugleich die Idee der Stadtasyle mit der Einrichtung von kleinen stationären Einheiten in der Gemeinde, der Beachtung der Lebensbedingungen und der ambulanten Nachsorge (vgl. Dörner 2012, S. 485). Griesinger kann rückblickend als erster Gemeindepsychiater gezählt werden. Sein Augenmerk galt jedoch in erster Linie den akut Kranken, die chronisch Kranken sollten auch bei Griesinger weit weg in Anstalten untergebracht werden. Auch viele Philosoph_innen jener Zeit beschäftigten sich mit der Psychiatrie und warfen die Frage auf, ob seelische oder körperliche Ursachen wichtiger seien. Am Ende des 19. Jahrhunderts galt die Psychiatrie jedoch schließlich überall als Unterdisziplin der Medizin und hatte mit ihrer „Selbsteinengung auf den Körper“ (Dörner 2012, S. 486) Erfolg.
Die naturwissenschaftlich-objektivierende Fallbeobachtung nach Symptomatik und Krankheitsverlauf verfeinerte sich zusehends, vor allem durch Emil Kraeplin (1856-1926) und Eugen Bleuler (1857-1939). Kraeplins diagnostische Grundbegriffe haben auch heute immer noch Bestand und dienen nahezu weltweit im Rahmen der „internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Grundlage für die Erfassung psychischer Krankheiten. Das Interesse an den Patient_innen ist begünstigt durch dieses Klassifikationssystem vorwiegend diagnostisch, klassifikatorisch und beschreibend-pathologisch. Die Therapien werden auf Basis der körperlichen Ursachen psychischer Erkrankungen kausal abgestimmt (vgl. Dörner 2012, S. 483-485). Das biologisch ausgerichtete psychiatrische Krankheitsverständnis ließ eine Aufteilung in biologisch Gesunde und biologisch Kranke zu – eine weitere Objektivierung des Menschen war die Folge. Diese monokausal-biologische Betrachtungsweise spitzte sich schließlich in den 1920er Jahren dahingehend zu, dass man vorrangig davon ausging, dass psychische Krankheiten erblich bedingt waren (vgl. Thom 1990, S. 23).
Der Höhepunkt der psychiatrischen Entmenschlichung und Objektivierung findet sich schließlich in der Zeit des Nationalsozialismus (vgl. Lehmann 2013, S. 61). Degenerationslehre, Rassenhygiene und Sozialdarwinismus bildeten die Grundlage für die Massenmordaktionen im Dritten Reich. Ebenso Schriften wie „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ (Hoche/Binding 1920) des Psychiaters A. Hoche und des Juristen K. Binding. Ein zunehmend stärkeres Bewertungsdenken griff um sich. Psychisch kranke und geistig behinderte Menschen wurden systematisch verfolgt. Zwangssterilisationen zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, Hungersterben in den Kliniken und letztlich die T4-Aktion als geplante Euthanasie mit der Massentötung von behinderten Kindern und Erwachsenen ab 1939 sind nur einige Gräueltaten, an denen die Psychiatrie dieser Zeit beteiligt war (vgl. Schott 2006, S. 166 ff.).
Aber auch nach dem Nationalsozialismus blieb die traditionelle Psychiatrie stark reglementiert. Die Kliniktüren blieben geschlossen, Zwangsmaßnahmen waren an der Tagesordnung und die Patient_innen fristeten ihre Zeit in Ohnmacht und Unfreiheit. Es ging in dieser Zeit mehr um bewahren als um behandeln, mehr um Wohlverhalten als um Wohlbefinden. „Der Kranke wurde zum Objekt des Ordnungsstrebens im Krankenhausregime“ (Tölle 2004, S. 33).
Die größte Veränderung der Psychiatrie im 20. Jahrhundert begann rückblickend mit Sigmund Freuds (1856 – 1939) Psychoanalyse. Freud entwarf eine psychische Therapiemethode, die sehr provozierend auf die medizinisch eingeengte Psychiatrie wirkte (vgl. Dörner 2012, S. 483-485). Viele betrachteten die Psychoanalyse zeitweise sogar als den Endpunkt der Psychiatriegeschichte. Die Psychoanalyse versuchte Phasenweise zwischen 1890 und 1960 (dem Höhepunkt der psychoanalytischen Bewegung) die gesamte Psychiatrie an sich zu reißen und griff tief in die Psychiatrie ein (vgl. Shorter 1999, S. 233). Zeitgleich setzte auch die Wiederentdeckung sozialer Aspekte ein. Kolb empfiehlt 1908 das Erlanger Modell, ein Nachsorgemodell für die „offene Irrenfürsorge“. Die Sozialarbeit wird zu dieser Zeit erstmals integraler Bestandteil in der Psychiatrie (vgl. Dörner 2012, S. 483-485).
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts befand sich die Psychiatrie schließlich in einem Dilemma. Die Psychiater_innen hatten die Möglichkeit, Patient_innen in großen Anstalten unterzubringen oder den Patient_innen mit der Psychoanalyse eine Therapie anzubieten, die für psychisch schwer Erkrankte wenig geeignet war. Aus der Zwickmühle dieser beiden nicht zufriedenstellenden Möglichkeiten begannen sich im 20. Jahrhundert viele verschiedene Alternativen zu entwickeln. Einige Ansätze wurden schnell wieder verworfen, andere bildeten die Grundlage für neue psychotherapeutische Ansätze und wiederum andere legten das Fundament für die „pharmakologische Revolution“, die nach dem 2. Weltkrieg begann (vgl. Shorter 1999, S. 233).
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich jedoch schließlich ein tiefgreifender und umfassender Paradigmenwechsel, der in weiten Teilen zu einer grundsätzlichen Reformierung der Psychiatrie führte (siehe Kapitel 4).
H. Schott und R. Tolle fassen die Entwicklung der Psychiatrie bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts treffend zusammen, wenn sie bemerken: „Die Psychiatrie erwies sich nicht als überflüssig, wohl aber als veränderungsbedürftig und veränderungsfähig“ (Schott/Tolle 2006, S. 213).
2.3 Behandlungsgrundlage und Therapieformen
Im folgenden Kapitel wird zunächst die Behandlungsgrundlage der traditionellen Psychiatrie – die Diagnostik – beleuchtet. Anschließend werden die tradierten psychiatrischen Behandlungsansätze – die Pharmakotherapie und die Psychotherapieschulen der Psychoanalyse und Verhaltenstherapie – vorgestellt und im Hinblick auf ihre Objektorientierung untersucht.
2.3.1 Diagnostik und Krankheitsverständnis
„Der diagnostische Blick, der Blick auf den Anderen, kann etwas Einengendes und Festlegendes haben, das den Anderen zum Objekt des Urteilens macht, ihn auf bestimmte Eigenschaften, auf ein bestimmtes „Sosein“ festnagelt und ihm dadurch die Freiheit raubt“ (Sartre 1953).
Den Begriff Diagnose gibt es etwa seit dem 18. Jahrhundert – er lässt sich mit „Unterscheidung“ übersetzen. Diagnosen dienen sowohl der Identifikation als auch der Zuordnung zu einer Krankheit und sollen die Auswahl eines bestimmten Therapieverfahrens erleichtern. Die „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD) ist heute das wichtigste und weltweit anerkannte Diagnoseklassifikationssystem. Dieses System entstand bereits 1893 und gründete sich auf der damaligen Sterbeursachenstatistik. 1948 übernahm die Weltgesundheitsorganisation die Verantwortung über das Klassifikationssystem ICD, welches mittlerweile in der 10. Fassung (ICD 10) vorliegt. Dieses Klassifikationssystem basiert auf dem biomedizinischen Krankheitsmodell der traditionellen Psychiatrie (vgl. Pfleger 2013).
Bei der Diagnostik psychischer Störungen treten vor allem zwei Schwierigkeiten in den Vordergrund: Es besteht zum einen eine grundsätzliche Gefahr, mit den Mitteln der diagnostischen Systeme falsche Diagnosen zu stellen und zum anderen den Menschen hinter den Diagnosen nicht mehr unmittelbar wahrzunehmen: Diagnosen sind idealtypisch konstruiert und sagen letztlich wenig über die Ausprägung der Symptome und noch weniger über die Bedeutung der Störung für das Leben des Individuums aus. Klaus Dörner kommt zu dem Schluss, dass angesichts der Unzuverlässigkeit der psychiatrischen Diagnostik und der unzureichenden Beziehung zwischen Diagnostik und Therapie, die ganze psychiatrische Diagnostik nach dem Modell der Biomedizin in Frage zu stellen sei und dem eigenen Anspruch Ordnung und Handlungsanweisungen zu geben nicht gerecht werden könne (vgl. Dörner 1975, S. 140 ff.). Besonders die psychiatrische Diagnostik erscheint sehr fehleranfällig: „Wenn sie die Gelegenheit haben, dann finden Psychiater überall Krankheit“, so die Medizin-Journalistin Lynn Payer. Sie verweist auf ein Beispiel, bei dem von 1000 Personen die in die Notaufnahme eines Krankenhauses kamen und zunächst von Psychiater_innen untersucht wurden, 98% eine psychiatrische Diagnose erhielten (vgl. Blech 2014, S. 34). Ähnliche Ergebnisse traten mit dem sogenannten Rosenhahn Effekt hervor, bei dem sich völlig gesunde Scheinpatient_innen unter falscher Diagnose in die Psychiatrie einliefern ließen, sich dort aber ganz normal verhielten. Die Frage lautete wie lange es dauern würde, bis die Ärzt_innen erkennen würden, dass es sich um ganz gesunde Menschen handeln würde. Dieser Versuch machte auf die scheinbar oft vorkommende Willkür der Psychiater_innen aufmerksam und stellte die Glaubwürdigkeit der Psychiatrie in Frage (vgl. ebd., S. 37).
Ein Problem bei der Diagnostik psychiatrischer Krankheiten ist zudem darin zu sehen, dass die Diagnostik vor allem auf Symptomen beruht und die Umwelt als auch die sozialen Faktoren ausblendet (vgl. Blech 2014, S. 48). Vor allem aber das subjektive Erleben der Betroffenen wird mit dem objektivistisch-deskriptiven Ansatz nicht ausreichend berücksichtigt (vgl. Brücher 2013, S. 56 ff.). Die Psychiatrie legt die Patient_innen auf Defekte fest und wird dem Menschen mit dieser Reduzierung auf das Symptom nicht gerecht – es führt häufig dazu, dass sich nicht mehr ernsthaft auf den Betroffenen eingelassen wird. Die psychiatrische Entwicklung erscheint hierbei besorgniserregend – ein rasanter Anstieg psychischer Erkrankungen ist zu verzeichnen. Depressionen und Angsterkrankungen haben mittlerweile das Ausmaß von Volkskrankheiten angenommen. Der Anstieg der Verordnungen von Psychopharmaka für Depressionen liegt bei ca. 15 % pro Jahr. Eine Zunahme psychischer Erkrankungen ist auch auf einen Anstieg der als psychische Störungen definierten Erkrankungen zurückzuführen. Psychische Störungen werden durch Mehrheitsbeschlüsse – quasi per Handzeichen – der Mitglieder der amerikanischen Psychiatrievereinigung (APM) in das diagnostische und statistische Manual psychischer Störungen (DSM) gewählt (vgl. Brücher 2013, S. 57). Im Gegensatz zu den psychischen Störungen in den Diagnostiksystemen sind die Grenzlinien zwischen den Störungen in der Realität jedoch viel verschwommener. Für eine depressive Störung beispielsweise müssen fünf Kriterien über einen Zeitraum von zwei Wochen existieren. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine wissenschaftliche Notwendigkeit, sondern um eine (praktische) „willkürliche“ Entscheidung (vgl. Frances 2013, S. 54). Inzwischen bestehe die Chance jede Befindlichkeitsstörung als psychische Störung zu diagnostizieren, zu therapieren und zur Krankheitswertigkeit hochzustilisieren (vgl. Dörner 2012, S. 493). Psychiatrische Diagnosen vermögen es nicht, den Menschen in seiner Einzigartigkeit zu beschreiben und sind daher auch massiver Kritik ausgesetzt. Die antipsychiatrische Bewegung der 1960er und 1970er Jahre (siehe Kap. 4.1.2) kritisierte die gängigen Formen der Diagnose und Klassifikation als schädigende Etikettierungen und behauptete, dass die Diagnosen und Etikettierungen Ausgrenzung fördern würden (vgl. Paulitsch 2008, S. 75).
2.3.2 Psychopharmakotherapie und Psychotherapie
„Wer sich des Anderen bemächtigen wollte (und sei es nur in Form von Interpretationen oder Deutungen über den Anderen), der zerstört die personale Qualität der Beziehung und führt sie in eine Beziehungsform über, in der Einer den Anderen zum Objekt macht“ (Schmidt 2001, S. 70).
Im Folgenden sollen die Pharmakotherapie und die Psychotherapie – als traditionelle Bausteine der Behandlung psychischer Krankheiten in der Psychiatrie – vorgestellt und im Hinblick auf ihre Objektorientierung untersucht werden.
Psychopharmakotherapie: Besonders das Thema Psychopharmakotherapie – also die somatische Behandlung psychischer Krankheiten mit Arzneimitteln (Psychopharmaka) – bietet für Viele Anlass zu einer kontroversen Auseinandersetzung. Muss auf der einen Seite festgehalten werden, dass Psychopharmaka sicherlich eine wertvolle Entdeckung für die Behandlung schwerer psychischer Störungen waren, haftet ihnen bei vielen Kritikern ein sehr schlechtes Image an (vgl. Börner 2001, S. 269). Diese erachten Psychopharmaka vor allem im Kontext der Psychiatrie und bei „schwierigen“ Patient_innen nur als eine moderne Fortsetzung der Gewalt – medienwirksam auch als „chemische Zwangsjacke“ tituliert. Auf den psychiatrischen Stationen sei es durch die Medikamente zwar ruhiger, aber nicht humaner geworden. „Den Menschen hat sie immer noch nicht erreicht“ (Kurtschinski 1978, S. 38). Für andere wiederum sind die Psychopharmaka ein Segen. Und tatsächlich scheinen sie gerade bei schwer psychisch Erkrankten eine Möglichkeit zu weniger Leid zu sein. Zu Beginn der Psychopharmaka-Ära war die Orientierung vor allem auf die Reduktion von Symptomen gerichtet. Der Umgang mit Psychopharmaka erfolgte hierbei sehr großzügig. Die subjektive Befindlichkeit der Patient_innen fand hierbei jedoch kaum Beachtung. Psychopharmaka setzen meist eben nicht beim Menschen an, sondern bekämpfen in erster Linie Symptome (sehr mechanisch), mit denen sich abweichendes Verhalten äußert (vgl. Kurtschinski 1978, S. 38). Der Mensch wird hierbei auf seine Symptome reduziert und in seiner Individualität häufig nicht wahrgenommen. Zudem werden die Patient_innen nur selten ernsthaft in die Therapie eingebunden. Wünsche der Andersdosierung werden oft abgetan und auf die Wünsche der Betroffenen wenig eingegangen. Psychopharmaka werden in der Absicht verschrieben, Symptome zu lindern. Dazu greifen sie in die Regulation von Hirnfunktionen ein und beeinflussen auf diese Weise Gefühle, Denken und Verhalten. Betroffene können auf diese Weise (vor allem bei Neuroleptika) den Kontakt zu ihren Gefühlen verlieren (vgl. Clausen 2010, S. 245). Denn Psychopharmaka unterdrücken Symptome psychischer Störungen wie Angst, Depressivität oder Halluzinationen. Dabei verhindern sie aber häufig eine ernsthafte Selbstauseinandersetzung. Psychopharmaka sind oftmals nur Krücken und können nur selten ein neues Bewusstsein vermitteln. Psychopharmaka machen Kranke wie auch die Krankheit „beherrschbar“. Aber auch andersherum betrachten viele Patient_innen die Ärzt_innen nur noch als Beschaffer von Medikamenten. Das Arzt-Patient Verhältnis wird dabei häufig zweitrangig (vgl. Shorter 1999, S. 482).
Dennoch haben auch die Psychopharmaka die Möglichkeit, wenn sie in eine entsprechende Sozio- und Psychotherapie eingebettet wird, chronische Krankheitsverläufe erwiesenermaßen zu verhindern. Wichtig ist hierbei, und das findet leider viel zu selten Anwendung, sich auf die Patient_innen einzulassen, sie samt ihrer Erkrankung kennenzulernen (vgl. Börner 2001, S. 270 ff.).
Psychotherapie: Einen ganz wesentlichen Bereich der psychiatrischen Behandlung nimmt die Psychotherapie ein. Die beiden ersten und wegweisenden Therapieschulen (nach wie vor die beiden einzigen Ansätze mit Kassenzulassung) stellen die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie dar, die nachfolgend in ihren Grundzügen vorgestellt werden sollen.
Psychoanalyse: Die Psychoanalyse, zurückgehend auf ihren Begründer Sigmund Freud (1856-1939), war in ihren zentralen Konzepten richtungsweisend für viele nachfolgende Psychotherapieschulen. Die Psychoanalyse, als expertenzentrierter Ansatz sieht den Menschen vor allem durch das Unbewusste und durch seine Triebe bestimmt (vgl. Boeger 2009, S. 30). Diese Theorie bildet gleichzeitig den Zugang für die Analytiker_innen in der Therapie. Die Analytiker_innen orientieren sich weniger an den Klient_innen und ihrem subjektiven Erleben, als vielmehr an dem Unbewusstsein der Klient_innen, für dessen Deutung und Aufklärung sie sich als Expert_innen verantwortlich sehen. Freud postulierte das Modell der drei Persönlichkeitsinstanzen: das Es (nicht sozialisierte Triebe, Unbewusstsein), das Über-Ich (Instanz des Gewissens und der Moral, gesellschaftliche Normen) und das Ich (Verwalter des bewussten Handelns, Realitätskontrolle). Zwischen diesen Persönlichkeitsinstanzen kann es zu Konflikten kommen, die es durch die Analytiker_innen aufzudecken gilt (vgl. Brückner 2010, S. 118). Die klassische Psychoanalyse sieht die Klient_innen und die Therapeut_innen klar getrennt voneinander. Die Therapeut_innen sind die Fachpersonen und als außenstehende Expert_innen die Realität und Vernunft vertretend. Eine reale therapeutische Beziehung und Begegnung tritt zugunsten des Übertragungs- und Deutungsverständnisses der Psychoanalytiker_innen in den Hintergrund (vgl. Korbei 2010, S. 432). Die Analytiker_innen konfrontieren die Patient_innen mit ihren Erlebnisinhalten und setzen sie in einen biografischen Zusammenhang (Deutung) (vgl. Hell 2011, S. 39). Eine Verstärkung der Symptome in der Therapie wird häufig sogar als Erfolg der „Übertragung“ erachtet. Die Psychoanalyse richtet den Blick in erster Linie auf die Defizite der Vergangenheit und legt ein grundsätzlich pessimistisches Menschenbild zu Grunde – der Mensch wird von seinen Trieben gesteuert. Dieser dogmatische Ansatz – in „Reinform“ praktiziert – hat etwas Entmündigendes und zwingt die Klient_innen in ein Abhängigkeitsverhältnis (vgl. Adamaszek 1987, S. 63).
Verhaltenstherapie: Die Verhaltenstherapie setzt am beobachtbaren Verhalten an. Das therapeutische Selbstverständnis der Verhaltenstherapeut_innen beruht im Wesentlichen auf den Annahmen zur Lerntheorie. Der Mensch wird nach der klassischen Lerntheorie allein durch die Umwelt oder durch Lernprozesse gesteuert. Die Beeinflussung des Menschen findet von außen statt und nicht von innen – ein Ansatz der in gewisser Weise charakteristisch für die gesamte traditionelle Psychiatrie ist. Diese deterministischen Ansätze halten Gesetze, Kontrollmaßnahmen und Verbote für ganz wesentlich, um auf Verhalten Einfluss zu nehmen (vgl. Goble 1979, S. 140). Alle Verhaltensweisen sind durch Lernprozesse bedingt und somit auch durch Lernprozesse veränderbar. Die Persönlichkeitsstruktur und das individuelle Selbstkonzept spielen hierbei keine Rolle. Die Verhaltenstherapeuten betrachten den Menschen als „tabula rasa“, der als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommt und erst durch die individuellen Erfahrungen zur Persönlichkeit geformt wird. Der Mensch ist nach Ansicht der Verhaltenstherapeut_innen entsprechend form- und konditionierbar. Die Verhaltenstherapeut_innen behandeln entsprechend direktiv. Die „Arbeitsbeziehung“ ist sehr funktionell. Durch die Methode der operanten Konditionierung können Verhaltensweisen auf und auch abgebaut werden, indem auf ein Verhalten eine direkte Konsequenz folgt (Belohnung oder Bestrafung). Der Organismus wird somit als Black Box verstanden, bei der Reizsetzungen (Input) und die daraus resultierende Reaktion (Output) im Vordergrund stehen. Das Menschenbild der Verhaltenstherapie kann als sehr mechanistisch beschrieben werden. Die Verhaltenstherapie orientiert sich vorrangig an den zu bekämpfenden Symptomen und ist allgemein sehr reduktionistisch ausgerichtet. Der Mensch wird als nicht autonomes Wesen gesehen, dessen Verhalten vorhersehbar und steuerbar ist. Die Betrachtung von Gefühlen und Emotionen wird weitestgehend ausgeblendet – Selbstreflexion und die Hinwendung auf die individuellen Gefühle und Empfindungen sind für die Verhaltenstherapie keine Grundlage einer objektiven Wissenschaft. Sie setzt hingegen ganz auf die Messung und Objektivierung von Verhaltensweisen. Der Mensch wird als passives Wesen, das von seiner Umwelt gesteuert wird und keine Möglichkeit zur freien Entscheidung hat, betrachtet. Er ist nach Ansicht der Verhaltenstherapeut_innen ein „Opfer“ seiner Umweltbedingungen (vgl. Boeger 2009, S. 145 ff.).
2.4 Institutionelle Rahmenbedingungen
Im folgenden Kapitel wird auf die institutionellen Rahmenbedingungen der Psychiatrie eingegangen. Es soll zum einen verdeutlicht werden, in welche Strukturen die Psychiatrie eingebunden ist und zum anderen soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen diese Strukturen auf die psychiatrische Praxis haben und wie diese Strukturen zu einer Objektivierung des Menschen beitragen. Hierzu werden zunächst die Aufgaben und rechtlichen Rahmenbedingungen definiert, um anschließend die Aspekte „Macht, Zwang und Gewalt“ in den Blick zu nehmen. Das Kapitel schließt mit einem Exkurs zu aktuellen ökonomischen Einflüssen auf die Psychiatrie.
2.4.1 Aufgaben und rechtliche Rahmenbedingungen
Der gesellschaftliche Auftrag der Psychiatrie sieht zwei Aufgabenbereiche vor, die seit jeher oft im Streit liegen: Die Kontrolle und die Hilfe psychisch Kranker (vgl. Dörner 2012, S. 484).
Aus diesem doppelten Auftrag ergeben sich schließlich umfangreiche institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen – in Form von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen – auf die an dieser Stelle nur punktuell eingegangen werden kann. Besonders erwähnenswert im Rahmen dieser Untersuchung ist das Psychisch- Kranken-Gesetz (Psych-KG). Das Psych-KG ist Landesrecht und regelt in erster Linie die Verfahren zur zwangsweisen Unterbringung bei Selbst- oder Fremdgefährdung, sowie die Verpflichtungen der Gemeinden zur Nachsorge durch die Gesundheitsämter und Sozialpsychiatrischen Dienste. Da in Deutschland eine solche Unterbringung eine Freiheitsberaubung darstellt, muss hierzu zuvor eine richterliche Genehmigung eingeholt werden. Das Verfahren wird in der Regel von der Polizei oder einem Amt für öffentliche Ordnung eingeleitet. Die Psychiater_innen im Krankenhaus nehmen hierzu Stellung und die Richter_innen haben zu entscheiden, ob die Unterbringung gerechtfertigt ist (vgl. Paulitsch 2008, S. 30 ff.).
Ein weiteres wichtiges Gesetz, mit dem viele chronisch psychisch Kranke in Kontakt kommen, ist das Betreuungsgesetz: Können Betroffene psychischer Krankheiten oder anderer Behinderungen ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst wahrnehmen, greift häufig das Betreuungsgesetz, indem dem Betroffenen eine entsprechende Hilfe vom Amtsgericht zur Verfügung gestellt wird. Das Vormundschaftsgesetz wurde 1992 durch das Betreuungsgesetz abgelöst, wodurch die Rechte der Betroffenen gestärkt und die Selbstbestimmung erhalten werden sollte. Das Credo dieses neuen Gesetzes lautet „Partnerschaft statt Bevormundung“ (Bäuml 2015). Eine entsprechende Betreuung kann auf eigenen Wunsch oder von Amtswegen eingeleitet werden (vgl. Neuhäuser 2010, S. 108 ff.).
2.4.2 Macht, Zwang und Gewalt
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung die Behandlung psychisch Erkrankter – bei massiver Fremd- oder Selbstgefährdung – auch gegen den Willen der Betroffenen durchzuführen, wenn eine Unterbringung der Patient_innen zum Schutz der Patient_innen oder dem Schutz seiner Umgebung erforderlich erscheint. Und so kommt es nicht selten vor, dass Betroffene in psychischen Ausnahmezuständen auch unter Zwang und mit polizeilicher Gewalt in die Psychiatrie gebracht werden und dort mit Gurten fixiert oder einer Injektion mit sedierenden Psychopharmaka beruhigt werden. Solche Situationen entspringen dem gesellschaftlichen Auftrag der Psychiatrie. Selbstbestimmung und Freiheit des Menschen treten als Handlungsgrundlage hierbei in den Hintergrund. Die Psychiatrie als staatliche Instanz muss somit entscheiden, ob psychische Auffälligkeiten einer zwangsweisen Behandlung bedürfen (vgl. Paulitsch 2008, S. 30 ff.).
Macht, Zwang und Gewalt sind eine Notwendigkeit der traditionellen Psychiatrie, damit diese „funktioniert“. Nach Max Weber bedeutet Macht „innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichwohl worauf diese Chance beruht“ (Weber 1922). Zwang und Gewalt ist ohne Macht nicht denkbar. Die Psychiatrie hat zunächst einmal eine erhebliche Definitionsmacht. Diese Definitionsmacht im Hinblick auf Krankheit und abweichendem Verhalten ermöglicht der Psychiatrie eine erhebliche Kontrolle. Die Psychiatrie bestimmt, welches Verhalten als Abweichung zu definieren ist. Dieses Benennen-Können ist bereits eine gewisse Form der Macht – Bourdieu beschreibt sie als eine Form der symbolischen Macht. Sie kontrolliert einflussreich gesellschaftliche Normen und übt eine enorme normative Macht aus. Bei der Psychiatrie hingegen geht diese Macht darüber hinaus, da diese Benennungen in der Regel auch mit der impliziten Aufforderung nach Veränderung verbunden sind (vgl. Bruns 1998, S. 18).
Die Beziehung von Zwang und Gewalt ist von einer Beziehung der Ungleichheit – von einer asymmetrischen Beziehung – gekennzeichnet. Es gibt eine Person, die zwingt und es gibt eine Person, die wird gezwungen (vgl. Wienberg 1997, S. 15). Jedes Jahr werden rund 1,2 Millionen Patient_innen stationär psychiatrisch behandelt, etwa 150.000 davon gegen ihren Willen (vgl. Malachowski 2013). Verbände, die sich kritisch mit der Psychiatrie auseinandersetzen, schätzen, dass jeder Zehnte von ihnen jegliche Therapie ablehnt und unter Zwang behandelt wird (vgl. Langhammer 2013). Vielen von ihnen geht es nach der Psychiatrie schlechter als vorher, da sie oft ein zusätzliches Trauma erleiden. Eine zwangsweise Einweisung stellt eine erhebliche Verletzung der Freiheitsrechte dar. Deshalb dürfte eine solche Einweisung – wenn überhaupt – nur als allerletzter Schritt und nach einer sehr gründlichen Prüfung der individuellen Situation vollzogen werden. Jedoch sinken auch die gesetzlich geschaffenen Hürden scheinbar stetig. Das kontrollierende Amtsgericht stimmt nach der NRW-Statistik in rund 99 Prozent der Fälle umstandslos zu, was den Verdacht zulässt, dass sich in vielen Fällen nur unzureichend mit dem einzelnen Menschen und seiner individuellen Situation auseinandergesetzt wird (vgl. Annika Joeres 2011).
2.4.3 Exkurs: Ökonomische Einflüsse
Auch ökonomische Motive spielen bei der Versorgung psychisch Kranker eine bedeutende Rolle. Das allein ist noch nicht besorgniserregend. Die aktuellen Entwicklungen, die hierbei zu verzeichnen sind, sind im Hinblick auf die Fragestellung der Objektivierung des Menschen in der Psychiatrie jedoch beunruhigend. Psychiatrische Arbeit ist bestrebt, zunehmend kalkulierbarer und objektivierbarer zu werden – im Blickfeld stehen hierbei vor allem das Symptom, die Diagnose und dessen schnelle Linderung (vgl. Himmelmann 2012, S. 3). Die Psychiatrie befindet sich derzeit in einer Umbruchsphase, in dessen Zuge stufenweise ein neues Abrechnungssystem – das pauschalierende Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) – in psychiatrische Kliniken eingeführt werden soll. Das angestrebte Ziel dieses pauschalierenden Entgeltsystems ist, dass das Abrechnungssystem gerechter wird. Eingeführt wurde dieses leistungsorientierte Vergütungssystem von dem früheren FDP Gesundheitsminister Daniel Bahr – entwickelt wurde es vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (Inek). Auf Grund der starken Kritik seitens psychiatrischer Fachgesellschaften und Verbände sowie Patient_innen-Organisationen, und der Einsicht, dass eine Anpassung und Weiterentwicklung des Systems notwendig ist, wurde die verbindliche Einführung zwischenzeitlich verschoben. Nach einer 4-jährigen Einführungsphase von 2013 - 2016, soll PEPP und eine entsprechende Entgeltentwicklung zwischen 2017 - 2021 (Konvergenzphase) nun verbindlich umgesetzt werden (vgl. Bühring 2014).
Die Patient_innen werden bei diesem leistungsorientierten Abrechnungssystem nicht nur nach der Aufenthaltsdauer, sondern auch nach der Diagnose unterschieden. Als Behandlungsgrundlage gelten die Diagnosen nach dem ICD. Einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Menschen steht dieses System quasi konträr gegenüber. Das aktuelle Erleben und die Ausrichtung an dem individuellen Lebenskontext treten zu Gunsten einer Versorgung – ausgerichtet an der Diagnose – zurück. Der „falsche Anreiz“, der hierbei gesetzt wird, liegt vor Allem darin, dass Kliniken bestimmte Patient_innen-Gruppen bevorzugt aufnehmen könnten und diese auf Grund der degressiven Verweildauer-Vergütungsstruktur – Kliniken verdienen mit zunehmender Liegedauer der Patient_innen weniger – verfrüht entlassen werden könnten. Es wird Patient_innen geben, die sich aus Sicht der Kliniken nicht mehr rechnen werden – vor allem die Versorgung von schwer und chronisch Kranken könnte dadurch erheblich an Qualität einbüßen. Krankheitsverläufe werden hierbei, ähnlich rein somatischer Erkrankungen, wie eine Knieoperation objektiviert. Eine Vorhersage der Krankheitsverläufe ist jedoch kaum möglich, so die Kritiker dieses Abrechnungssystems (vgl. Hardenberg 2012). Eine weitere mögliche Folge könnte beispielsweise sein, dass die pharmakologische Behandlung – auf Kosten des therapeutischen Gesprächs – an Gewicht gewinnt, um Symptome stärker zu bekämpfen und um die Patient_innen noch eher zu entlassen (vgl. Feldwisch-Drentrup 2014).
Zwischenfazit: Der Mensch als Objekt
In diesem ersten Teil der Untersuchung, mit dem Blick auf die traditionelle Psychiatrie und dem kritischen Fokus auf ihre objektivierenden Anteile, wurde deutlich, dass die Psychiatrie in vielen Bereichen zu einer Objektivierung des Menschen neigt.
Der „Mensch als Objekt“ bedeutet, dass der Mensch in der traditionellen Psychiatrie nicht in seiner Individualität und seiner „Ganzheit“ wahrgenommen (Diagnostik) und mit den Mitteln der tradierten Therapieformen nur mit sehr beengtem biologisch-defizitorientierten Blickwinkel (symptomorientiert) behandelt (Pharmakotherapie, Psychotherapie) wird. Der „Mensch als Objekt“ wurde in der recht langen Geschichte der Psychiatrie die überwiegende Zeit von Ausgrenzung, Gewalt und Stigmatisierung bedroht. Der Mensch wurde in seinem Mensch-Sein nicht ernst genommen und wertgeschätzt – humanistische Werte konnten sich nur selten Bahn brechen. Der „Mensch als Objekt“ hat sich als vermeintlich unwissende Person stets einer bevormundenden Expert_innen-Kommission gegenübergesehen, die für ihn die Entscheidungen trug und stets besser als die Patient_innen selbst wusste, was die Betroffenen brauchen – „Subjekt versteht Objekt“ (Dörner 2010).
Die heilsame Bedeutung einer wertschätzenden, einfühlenden Beziehung spielt in der traditionellen Psychiatrie keine Rolle. Die Beziehung war stattdessen bis Mitte des 20. Jahrhunderts hierarchisch, autoritär und objektivierend. Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Einbezug in eine transparente Behandlung waren im Hinblick auf den „Menschen als Objekt“ von untergeordneter Rolle. Gewalt und Druck hatten hingegen Selbstverständlichkeitscharakter. Die Menschen wurden weggesperrt, weit weg untergebracht und auf dem Höhepunkt der Unmenschlichkeit und Objektorientierung zum „Wohle der Gesellschaft“ umgebracht (Nationalsozialismus).
Unter dem Begriff Objektorientierung in der Psychiatrie sind – vor dem Hintergrund der vorangestellten Untersuchung – folgende Schlüsselbegriffe zusammenzufassen: Fremdbestimmung, fehlende Autonomie der Betroffenen, Passivität, Reduzierung auf ein biologisches Krankheitsverständnis, reduktionistisches Menschenbild, etikettierende Diagnosen, Bekämpfung von Symptomen, kausal-mechanische Behandlungsmethoden, Defizitorientierung, hierarchische/autoritäre Strukturen, gesellschaftliche Ausgrenzung/ Isolierung in einer Anstaltspsychiatrie, Zwang und Gewaltanwendung.
Auf der Skala zwischen Objektorientierung und Subjektorientierung befand sich die Psychiatrie in allen untersuchten Bereichen, historisch betrachtet bis Mitte des 20. Jahrhundert sehr deutlich an dem Pol der Objektorientierung. Relativierend soll angemerkt werden, dass die vorangegangene Schilderung mit Blick auf die objektivierenden Anteile der Psychiatrie einer – auch der Veranschaulichung dienenden – sehr kritischen Untersuchung unterlag. Relativierend soll zudem noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die psychiatrische Herangehensweise in weiten Teilen auch den institutionellen Rahmenbedingungen und dem gesellschaftlichen Auftrag (Doppeltes Mandat) geschuldet ist. Diese Untersuchung der traditionellen Psychiatrie im Hinblick auf die Objektorientierung des Menschen soll in erster Linie eine Tendenz und eine Gewichtung aufzeigen, die – nimmt man sich eine subjektorientierte Psychiatrie zum Ziel – lange Zeit ungünstig ausgerichtet war.
Der geschichtliche Abriss verdeutlicht jedoch auch die historische Wechselhaftigkeit und – trotz teils rigider und institutionalisierter Strukturen – die Veränderungsfähigkeit der Psychiatrie. Doch die vorangegangene Schilderung ist keine rein historische, sie ist nur scheinbar rückwärtsgerichtet. Bevor in den nachfolgenden Kapiteln der Blick in die andere Richtung gelenkt werden soll – hin zum Subjekt – darf bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Objektorientierung nach wie vor ein kritisch zu betrachtendes Thema bleibt. Viele der vorangegangenen Schilderungen haben nach wie vor Gültigkeit. Auch der Exkurs zur Ökonomisierung der Psychiatrie führt die aktuelle Brisanz dieses Themas vor Augen.
Dennoch haben sich – seit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts – zum ersten Mal in der Psychiatriegeschichte, ernsthafte und nachhaltige Gegenkräfte entwickelt, die sich an anderen Werten orientierten und ein zunehmendes Bewusstsein dafür weckten, dass ein Paradigmenwechsel nötig war, um dem Menschen gerecht zu werden und ihm zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu verhelfen. Was der Psychiatrie fehlte war eine andere Ausrichtung, ein (anthropologisches) Gegengewicht, wie es im nachfolgenden Kapitel 3 exemplarisch, vielleicht sogar alternativlos, vorgestellt werden soll – eine Ausrichtung die zunehmend auch im psychiatrischen System Fuß fasste (siehe Kapitel 4).
[...]
- Arbeit zitieren
- Master of Arts David Hentschel (Autor:in), 2016, Vom Objekt zum Subjekt. Die (Gemeinde-)Psychiatrie vor dem Hintergrund des personzentrierten Ansatzes am Beispiel der Stadt Herne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378672
Kostenlos Autor werden
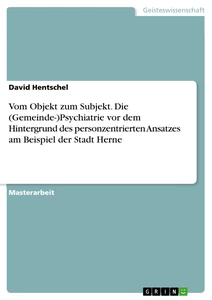



















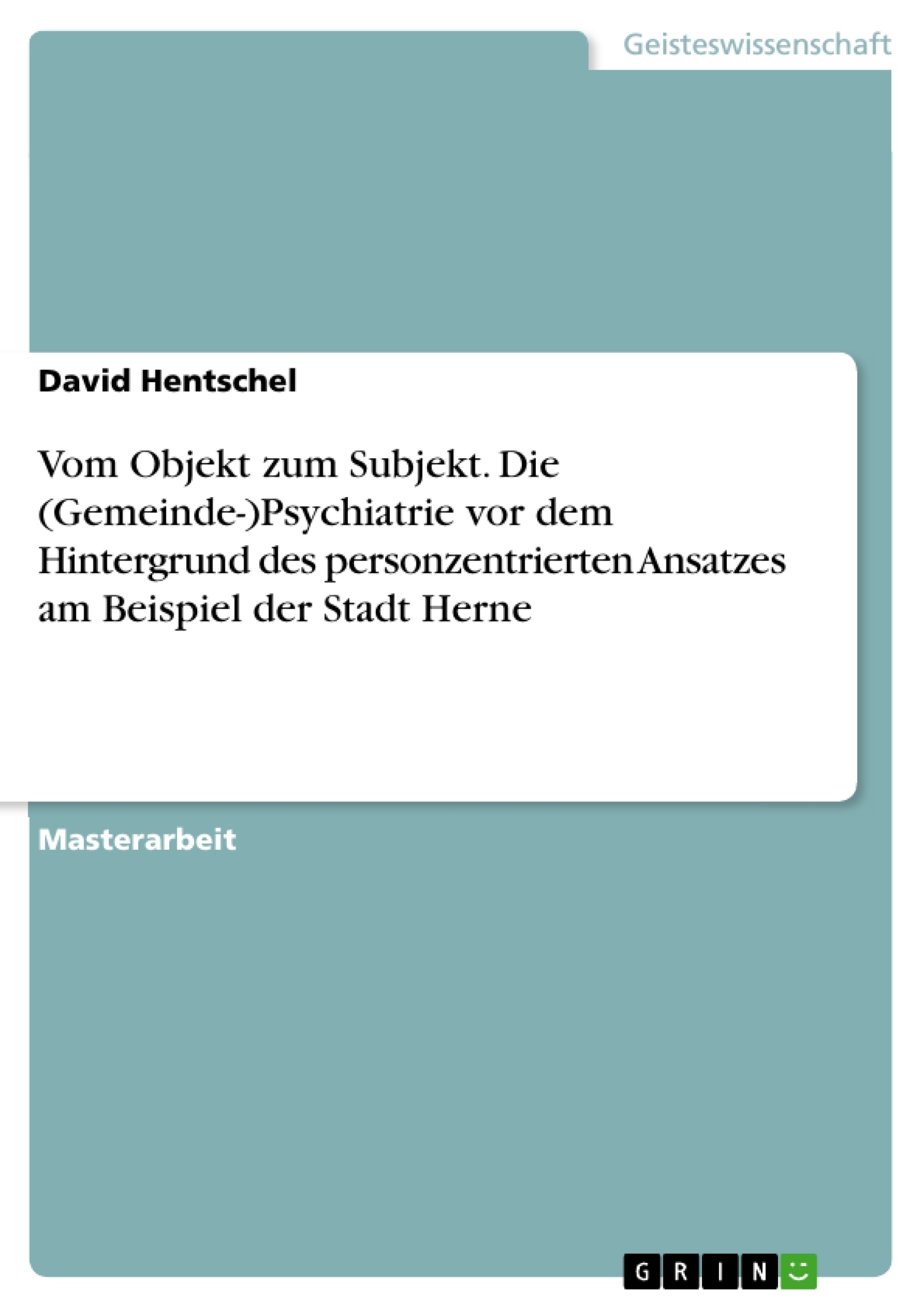

Kommentare